Umbruch ist ein starkes Wort, denn es meint hier: An die Stelle eines alten Systems, soll ein neues treten. Deutet sich etwa ein solcher Umbruch an – in Form eines Aufbruchs zu etwas Besserem?
Dr. Helmut Böttiger
Teil I
Tatsächlich erleben wir in letzter Zeit gehäuft „Einbrüche“. Nein, nicht nur in Häuser und Geschäfte wird eingebrochen. Hier geht es um anderes. So ist kürzlich der Wert des Euros eingebrochen und auf den Wert des Dollars herabgesunken. Der Sars-Covid 19-Virus hat mit Lockdown, Masken- und Impf-Forderungen fast das Gesundheitssystem in Frage gestellt. Die dramatisch fortschreitende Inflation hat die Versorgung vieler privater Haushalte einbrechen lassen und dort die Sorge verbreitet, wie man künftig noch über die Runden kommen solle. Verstärkt wurde das besonders durch den enormen Anstieg der Energie- und Treibstoffpreise. Schließlich sind blockierte Verhandlungen in einen Krieg ausgebrochen und steigern die Gefahr eines Atomkriegs bedrohlich. Mit der Zuspitzung solcher Krisen wächst die diffuse Angst in der Bevölkerung. Ihr Vertrauen in die Zukunft beginnt einzubrechen.
Darüber hinaus hat die Coronakrise die ideologische Spaltung in der Bevölkerung vertieft. Die Spaltung begann vorher und zwar seit den 1970er Jahren mit dem Begriff „Grenzen des Wachstums“.[1] Die gesellschaftliche Spaltung betraf zunächst die Zustimmung oder Ablehnung der vielfach aber zunächst wenig stichhaltigen Beweisführung, dass die Industriegesellschaft sich in relativ kurzer Zeit auf kaum zu überwindende Grenzen des Wachstums zubewege. Mit den Jahren verlagerte sich der Streit eher auf die Frage, welche Maßnahmen zu ergreifen seien, so dass der Widerspruch kaum in Erscheinung trat.
Er war aber nur übertüncht worden. Grenzen des Wachstums hatten sich in der bisher gut 4 Milliarden Jahren währenden Entwicklung des Planeten Erde immer wieder eingestellt. Sie haben letztlich die evolutionäre Entwicklung seiner Biosphäre vorangebracht. Demnach wäre auch jetzt an eine evolutionäre Überwindung der erneut in Erscheinung tretenden Grenzen zu denken, eine Evolution der sogenannten Noosphäre, wenn man so will. Dem gegenüber scheint sich aber die entgegengesetzte Meinung durchzusetzen, nämlich dass diesen Grenzen nur durch ein Zurückfahren von Produktion und Versorgung der Menschen zu begegnen sei und die Menschheit sich somit in das stationär verstandene Geschehen der derzeitigen Biosphäre einzupassen habe. Energie-Einsatz und -Verbrauch stehen hierbei im Mittelpunkt der Betrachtung.
Neben allgemein vertretenen Forderungen, sich in die statisch interpretierte Biosphäre einzuordnen, finden evolutionär ausgerichtete Gegenstimmen kaum noch Beachtung und treten allenfalls noch im Streit um die Nutzung der Kernbindungskräfte (Atomenergie) auf. Der Streit spitzte sich zu, weil nun auch massive Einschränkungen bei der Nutzung fossiler Energieträger gefordert werden. Das wird damit begründet, dass deren Abgase, das Kohlendioxid CO2, neben Wasser die Grundnahrung der Pflanzen, angeblich das Klima bedrohlich erwärmen. Die alternativen Energiequellen, auf die stattdessen verwiesen werden, sind nicht nur knapp, sie verlangen eine drastische Senkung des Lebensstandards und der Anzahl der Menschen. Sie greifen selbst bedenklich in die Umwelt ein, was erstaunlicherweise kaum beachtet wird.
Oder sehen wir das zu pessimistisch, reden den Aufbruch in ein neues Leben schlecht? ?
Nehmen wir zum Beispiel die Windenergie.
Die Technik der Windkraftwerke gilt als sicher und gut handhabbar.[2] Das wird kaum bestritten. Doch Windkraftwerke gefährden in erheblichem Umfang Vögel, Fledermäuse und vor allem Insekten, die zu sogenannten Schlagopfern werden. Die Quantifizierung der Schäden erweist sich als schwierig, weil Tiere, wie z.B. Füchse, die weggeschleuderten Kadaver verzehren. Der Schlagschatten der Rotoren belästigt Anwohner. Die niedrig-frequente Druckwelle, die das Vorbeigleiten des Rotorblatts am Turm erzeugt, löst bei allen Lebewesen in ihren Luft- oder Gas-gefüllten Hohlräumen, wie z.B. in den Lungen, sogenannte Barotraumata aus, die vor allem bei Fledermäusen traumatische bis tödliche Auswirkungen haben. Sie können neben dem damit verbundenen Infraschall auch empfindliche Menschen gesundheitlich schädigen.
Für den Flächenbedarf einer Windkraftanlage mit dem Zuweg für die Montage und Wartung rechnet man bei der Drei-Megawatt-Klasse eine befestigte und freizugängliche Fläche von etwa 2.500 m². In Wälder geht man von einem Bedarf von 0,47 ha aus. Das scheint im Vergleich zu anderen Anlagen wenig zu sein. Unberücksichtigt bleiben die wegen der erzeugten Windschatten benötigten Abstände der Anlagen von einander und damit die Streuung der Windanlagen über Land. Das Land zwischen den Windkraftanlagen kann weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Das gilt wesentlich weniger für Solaranlagen, wenn sie nicht auf Hausdächern, über Straßen und befestigten Plätzen errichtet werden.
Der Rohstoffverbrauch dieser zwischen mit 20 bis 25 Jahren relativ kurzlebigen Kraftwerke ist erheblich, vor allem wenn man die wegen der unsteten Energiebereitstellung erforderliche Energiespeicherkapazität hinzurechnet. Hier spielt vor allem der Bedarf an sogenannten seltenen Erden eine Rolle, deren Rückgewinnung aus dem Abfallschrott noch größere Probleme aufwirft. Das gleiche gilt für den Sondermüll aus den GFK-Fasern und Klebstoffen der Rotoren, die bisher noch nicht recycelt werden können.
Kaum berücksichtigt wird in der Diskussion die Klimawirksamkeit der großen Anzahl an Windkraftanlagen. Diese besteht im Abbremsen der Windgeschwindigkeit. Dadurch wird nicht nur der Kühleffekt des Windes gemindert, sondern auch seine Transportfähigkeit von Luftfeuchtigkeit vom Meer an Land. Inzwischen beobachten Meteorologen ein „Global Terrestrial Stilling“, das in etwa 10 m Höhe über dem Erdboden zunehmend gemessen wird. Das trägt sowohl zur Klimaerwärmung bei wie auch zu zunehmender Austrocknung, was sich u.a. im früher sehr niederschlagsreichen Norden Deutschlands bemerkbar macht. Selbst die Windenergiebranche kommt nicht umhin, den Rückgang der mittleren spezifischen Leistung schon bestehender Windkraftanlagen in den Jahren von 2012 bis 2019 im Norden um 30 %, in der Mitte um 23 %, im Süden um 26 % festzustellen.[3]
Dem globalen terrestrischen Stilling wird inzwischen eine große wissenschaftliche, sozioökonomische und ökologische Bedeutung beigemessen, weil selbst kleine Windgeschwindigkeitsänderungen die atmosphärische und ozeanische Dynamik und verwandte Bereiche entscheidend beeinflussen, etwa die Landwirtschaft und Hydrologie aufgrund der sogenannten Evapotranspiration (alle Arten des Übergangs des Wassers vom Land in die Atmosphäre), [4] die Migration durch Wind verbreiteter Pflanzenarten, [5] die Ausbreitung von Schadstoffen über die Luft [6] etc. Uneinheitlich wird noch der Einfluss auf höher gelegene Standorte beurteilt, besonders auf solche, die einen Großteil unserer Süßwasservorräte liefern.[7] Es zeigt sich aber, dass die Windgeschwindigkeiten dort sogar schneller abnehmen als an Standorten niedrigerer Höhen. [8] Schließlich entsteht bei der Umwandlung der Windenergie in el. Strom zu einem erheblichen Anteil (über 45%) Abwärme, die das Klima möglicherweise mehr erwärmt, als CO2 dies kann.[9]
Der Einfluss der Energieentnahme aus dem Wind in Bezug auf Umwelt und Klima wurde in der Öffentlichkeit kaum erwähnt. Das war und ist unverantwortlich, denn laut Studienlage verstärken wir dadurch den sogenannten Klimawandel (die Erderwärmung), anstatt ihn abzumildern.
Ist eine Klimaerwärmung, gravierend und menschgemacht durch CO2 (tatsächlich () weglassen) wissenschaftlich eindeutig belegt?
Die Klimaerwärmung durch Zunahme von CO2 in der Atmosphäre ist bisher keineswegs „wissenschaftlich“ erwiesen, wie behauptet wird. „Wegen fehlender physikalischer Beweise, dass CO2 eine globale Erwärmung verursacht, beruht das Argument, CO2 sei Ursache der Erwärmung, auf Computer-Modellierungen“, schrieb der Geologe Don Don J. Easterbrook bisher unwidersprochen.[10] Modelle liefern keine Beweise, allenfalls Erklärungen und die brauchen nicht zuzutreffen. Das gilt vor allem für die vielfach genannten 33°C Treibhausgaserwärmung aus einem erstaunlich falsch berechneten Unterschied zwischen Erde ohne und mit Atmosphäre.[11] Eine „Falsifizierung der atmosphärischen CO2 – Treibhauseffekte im Rahmen der Physik“ (englisch) lieferten bisher unwiderlegt Prof.
Gerhard Gerlich (Institut für Mathematische Physik, Technische Universität Braunschweig) und Dr. Ralf D. Tscheuschner bereits im Oktober 2009. [12]
Die Vertreter der „Klimasensitivität von CO2“ berufen sich gerne auf die sogenannte Rückstrahlung der vom erwärmten Erdboden abgegebenen Strahlung, die vom CO2 remittiert wird. CO2 absorbiert und emittiert hauptsachlich in der engen Bande von 15 Mikrometer (μm), Pflanzen tun das vorwiegend in der Bande 3,3 μm, Gestein zwischen 8 und 12 μm. Flüssiges Wasser emittiert im gesamten mittleren IR-Spektrum, besonders aber zwischen 2,8 und 8,3 μm. Daher sagte Prof. Reimund Stadler vom Institut für Organische Chemie der Universität Mainz bereits 1994: „Die Strahlungen, die vom Kohlendioxid absorbiert werden können, werden bei der vorhandenen Kohlendioxidmenge bereits vollständig eingefangen. Mehr geht nicht! Der konstruierte Zusammenhang zwischen global warming und Kohlendioxidemission entbehrt einer wissenschaftlich kritisch überprüfbaren Grundlage.[13] Demnach ginge von einer Zunahme an CO2 in der Atmosphäre keine zusätzliche Klimaerwärmung aus.
Wenn behauptet wird, CO2 würde die absorbierte Strahlung ringsum, also auch zum Teil wieder zum Boden zurückstrahlen, mag das zutreffen. Dass dies den Boden aufwärmen könnte, widerspricht eindeutig den Strahlungsgesetzen, die in Verbindung mit Rudolf Clausius‘ zweitem Hauptsatz der Thermodynamik vor allem auf Max Planck und Albert Einstein zurückgehen und bisher nicht widerlegt sind.[14]. Der wärmere Erdboden lässt sich nicht ohne Arbeit von der Strahlung eines kälteren Gegenstands erwärmen. CO2 leistet diese Arbeit jedenfalls nicht. Die Atmosphäre wird vor allem durch die Strahlung des wärmeren Erdbodens erwärmt, dieser aber nicht durch die darüberliegende, kältere Atmosphäre. Eine Erwärmung der Atmosphäre durch Stoßaktivierung seitens angeregter CO2-Molekülen ist bei ihrem Verhältnis von 4 zu 10.000 anderen Luftmolen kaum messbar. Neben dem Strahlungsgeschehen müssten auch alle anderen Arten der Energieströme, wie Aufstieg der latenten Wärme (pro Sekunde verdunsten auf der Erde 14 Mio. t Wasser, der Dampf steigt auf und regnet weiter oben abgekühlt wieder ab.) oder die Umwandlung der Sonnenenergie dank der Photosynthese der Pflanzen mitberücksichtigt werden, was im Diskurs der Klimaerwärmung durch CO2 in der Regel nicht geschieht.
Die gängigen Erklärungen des angeblichen Treibhauseffekts stützen sich auch auf die irrige Annahme, dass die gemittelte Temperatur (Durchschnittstemperatur der Erdoberfläche) irgendeine physikalische Bedeutung habe. Eine solche mittlere Temperatur hat mit einer Energiebilanz, aus der zumeist der Treibhauseffekt abgeleitet wird, nichts zu tun. Bei einer physikalisch vernünftigen Analyse müssten stets Temperaturfelder, also Bereicher von beobachtbaren, lokal gemessenen Temperaturen miteinander verglichen werden. Es müssten durch Messungen gestützte Belege vorgelegt werden, dass die lokalen Erhöhungen der Konzentration des Spurengases CO2 zu lokalen Temperaturerhöhungen führt und das lokale Wetter verändern und somit auch deren Statistik. Das ist bisher nicht geschehen.
Für die Zu- oder Abnahme des CO2-Gehalt der Atmosphäre sind weit mehr die temperaturabhängige Ozeanosphäre und die Biosphäre (Flora und Fauna) verantwortlich, als die Nutzung fossiler Brennstoffe. In der Biosphäre besorgen dies Schwankungen zwischen dem CO2-bindenden Pflanzenwuchs und der CO2-freisetzenden Ausatmung der Tiere und Menschen. In die Bodenerwärmung greift der Mensch mehr über die Gestaltung der Erdoberfläche, Siedlungsbau und Landwirtschaft, ein als über die industrielle CO2 Freisetzung.
Die CO2-Aufnahme oder Abgabe der Ozeane ist von der CO2-Konzentration in der Atmosphäre (seinem Partialdruck) und von der Wassertemperatur abhängig. Bekanntlich sind rund 71% der Erdoberfläche durchschnittlich 3000 m tief mit Wasser bedeckt. Meerwasser enthält etwa 50 Mal mehr Kohlenstoff als die gesamte Atmosphäre. Ein Liter Wasser bindet bei 0° C etwa 3,4g CO2, bei 20°C aber nur noch 1,7g. Die Erwärmung der Ozeane trägt also massiv zur Erhöhung des CO2 Gehalts der Atmosphäre bei und nicht umgekehrt. Vom Ozean absorbiertes CO2 wird im Oberflächenwasser zum großen Teil von Algen und Plankton verstoffwechselt. Das verbliebene CO2 wird allenthalben verbindet sich mit Kalzium in zu Kalkstein (CaCO3) umgewandelt (blaue Version bevorzugt). Das recht schwerlösliche CaCO3 sinkt tiefer und lagert sich bis in 5000 m Tiefe am Meeresboden ab.
Dort bilden sich allmählich Kalksteinschichten, die durch geologische Verschiebungen zum Teil als Kalksteingebirge an die Erdoberfläche gedrückt werden (Auf dem Festland gibt es angeblich etwa 2,8 x 1016 t Kalkstein). Die Kalksteinschichten werden aufgrund der Plattentektonik allmählich ins heiße Erdinnere hinab gedrückt. Im heißen Magma wird CaCO3 unter hohem Druck und unter Einwirkung von Eisen als Katalysator (Bakterien?! Nein) in Kohlenwasserstoffe (Erdgas etc.) umgewandelt. Von dort werden sie entweder durch Vulkane in die Atmosphäre abgegeben oder sammeln sich bei verhinderter Entgasung in alten oder neuen Lagerstätten.
Die Umwandlung von Kalkstein in Kohlenwasserstoffe unter Bedingungen wie sie Im Erdmagma herrschen gelang einer Gruppe um den Geologen Henry Scott an der Universität Indiana um 2004.[15] Dagegen ist es bis heute nicht gelungen, im Labor aus pflanzlichen oder tierischen Rückständen wie im Magma allein mit Druck und Hitze Kohlenwasserstoffe zu erzeugen. Das schafften bisher nur Lebewesen in anaeroben Gärungsprozessen. Dieses prinzipielle Unvermögen veranlasste schon 1963 den Nobelpreisträger für Chemie (1947), Robert Robinson, zu der Aussage: „Es kann nicht stark genug betont werden, dass Erdöl nicht die Zusammensetzung erkennen lässt, die von umgewandeltem biogenetischen Material zu erwarten wäre, und alle entsprechenden Hinweise auf solche Bestandteile in sehr altem Öl passen genauso gut oder sogar noch besser zu dem Konzept eines ursprünglichen Kohlenwasserstoffgemisches, dem später biologisches Material hinzugefügt worden ist.“[16]
Beide Recyclingprozesse von CO2 widersprechen nicht nur der CO2-Klima-Hypothese, sondern auch der Peak Oil Hypothese, nach der die Vorräte an Kohlenwasserstoffen auf der Erde bald verbraucht sein würden. Auf die These näher einzugehen, erübrigt sich, weil die vielen Explorationen neuer Lagerstätten die Peak Oil Hypothese verstummen ließen. Auf eine andere Ursache für die Erwärmungshypothese sei hier nur verwiesen, ohne näher darauf einzugehen, es sind dies Änderungen am Standort der Messstationen in Verbindung mit dem Wärmeinseleffekt. [17]
- Vgl. https://blog.hnf.de/an-den-grenzen-des-wachstums/. ↑
- Windenergie zur Erzeugung elektrischen Stroms wurde übrigens zuerst im Dritten Reich propagiert: Lawaczeck, F. (1933), „Technik und Wirtschaft im Dritten Reich – Ein Arbeitsbeschaffungsprogramm“ Verlag Frz. Eher Nachfolger München, S. 50 ff ↑
- So die Ergebnisse einer am 5. Oktober 2020 veröffentlichten Studie der Deutschen WindGuard im Auftrag des Bundesverbands WindEnergie e.V. mit dem Titel „Volllaststunden von Windenergieanlagen an Land – Entwicklung, Einflüsse, Auswirkungen“. ↑
- Vgl.u.a. McVicar TR, Roderick ML, Donohue RJ, Van Niel TG: (2012), Less bluster ahead? Ecohydrological implications of global trends of terrestrial near-surface wind speeds, in: Ecohydrol., 5(4), 381–388, doi:10.1002/eco.1298. ↑
- Thompson, S.E., and G.G. Katul: (2013), Implications of nonrandom seed abscission and global stilling for migration of wind-dispersed plant species, in: Glob. Chang. Biol., 19(6):1720–35, doi:10.1111/gcb.12173. ↑
- Vgl.u.a. Cuevas, E., Y. Gonzalez, S. Rodriguez, J.C. Guerra, A.J. Gomez-Pelaez, S. Alonso-Perez, J. Bustos, and C. Milford: (2013), Assessment of atmospheric processes driving ozone variations in the subtropical North Atlantic free troposphere, in: Atmos. Chem. Phys., 13(4), 1973–1998, doi:10.5194/acp-13-1973-2013. ↑
- Viviroli D, Archer DR, Buytaert W, Fowler HJ, Greenwood GB, Hamlet AF, Huang Y, Koboltschnig G, Litaor MI, Lopez-Moreno JI, Lorentz S, Schadler B, Schreier H, Schwaiger K, Vuille M, Woods R.: (2011), Climate change and mountain water resources: overview and recommendations for research, management and policy, in: Hydrology and Earth System Sciences 15(2): 471–504. doi:10.5194/hess-15-471-2011, und Viviroli D, Durr HH, Messerli B, Meybeck M, Weingartner R.: (2007), Mountains of the world, water towers for humanity: typology, mapping, and global significance, in: Water Resources Research 43(7): W07447, doi:10.1029/2006WR005653.. ↑
- McVicar TR, Van Niel TG, Roderick ML, Li LT, Mo XG, Zimmermann NE, Schmatz DR: (2010) Observational evidence from two mountainous regions that near-surface wind speeds are declining more rapidly at higher elevations than lower elevations: 1960–2006, in: Geophys Res Lett 37 (6): L06402. doi:10.1029/2009GL042255 und speziell für das Tibet-Plateau You, Q., Fraedrich, K., Min, J., Kang, S., Zhu, X., Pepin, N., Zhang, L.: (2014) Observed surface wind speed in the Tibetan Plateau since 1980 and its physical causes, in: International Journal of Climatology 34(6), 1873–1882. doi:10.1002/joc.3807. ↑
- Vgl.u.a. Lee Miller: The Warmth of Wind Power, in: Physics Today 73, 8, 58 (2020); https://doi.org/10.1063/PT.3.4553. ↑
- D.J. Easterbrook, Evidence-Based Climate Science. Elsevier, Amsterdam 2011, S. 400. Zu nennen wären hier u.a. etwa die Professoren Dr. G. Kramm oder Dr. G Gerlich. ↑
- Dass die effektive Strahlungstemperatur der Erde, egal ob eine Atmosphäre existiert oder nicht, überhaupt keine reale Temperatur ist, ist seit dem 1.2.1913 ü 100 bekannt, siehe R. Emden in: „Über Strahlungsgleichgewicht und atmosphärische Strahlung“ unter: http://ing-buero-ebel.de/Treib/Emden.pdf. Vgl. neuerdings Kramm, G.: (2020) https://www.coursehero.com/file/82172501/Bemerkungen-zur-Gleichung-von-Gerlich-unpdf/EMC Report No. 01-20200627. ( der geänderte Link klappte bei mir) ↑
- https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S021797920904984X ↑
- Mainzer Allgemeinen Zeitung vom 14.12.1994. Inzwischen nachgewiesen und bestätigt, W. A. van Wijngaarden, W. Happer: Relative Potency of Greenhouse Molecules, unter: arXiv:2103.16465v1 [physics.ao-ph] 30 März 2021. ↑
- Vgl. z.B unter anderen A. Einstein, P. Ehrenfest, Zur Quantentheorie des Strahlungsgleichgewichts, in: Zeitschrift für Physik, Vol. 19, (1923), S. 301–306. ↑
- Henry P. Scott, Russell J. Hemley et al., Generation of methane in the Earth’s mantle: In situ high pressure–temperature measurements of carbonate reduction, Proceedings of the US National Academy of Science PNAS, veröffentlicht am 20.9.2004, unter: http://www.pnas.org/content/101/39/14023.full. ↑
- Robert Robertson, Duplex Origin of Petroleum, in: Nature, Vol. 199, 1963, S. 113. ↑
- https://wattsupwiththat.com/2022/07/27/new-surface-stations-report-released-its-worse-than-we-thought↑



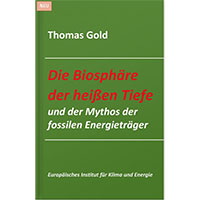
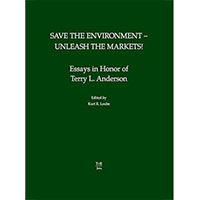
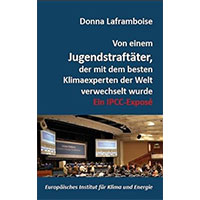
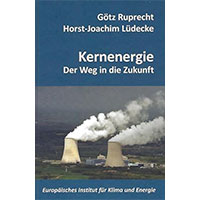
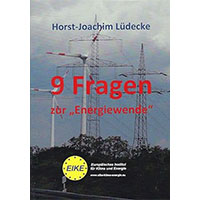
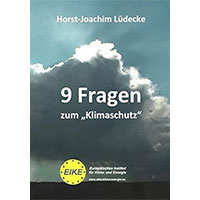
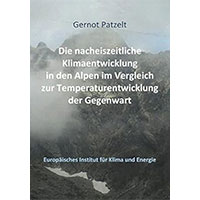
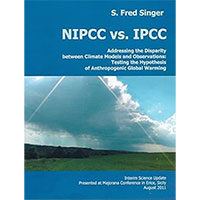
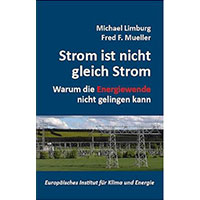
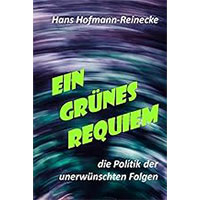


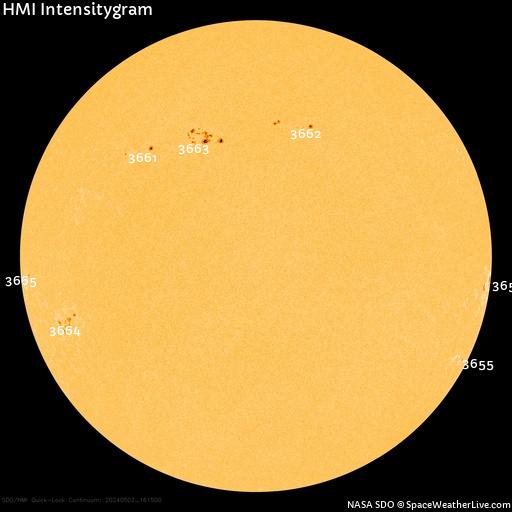
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
- Bitte geben Sie Ihren Namen an (Benutzerprofil) - Kommentare "von anonym" werden gelöscht.
- Vermeiden Sie Allgemeinplätze, Beleidigungen oder Fäkal- Sprache, es sei denn, dass sie in einem notwendigen Zitat enthalten oder für die Anmerkung wichtig sind. Vermeiden Sie Schmähreden, andauernde Wiederholungen und jede Form von Mißachtung von Gegnern. Auch lange Präsentationen von Amateur-Theorien bitten wir zu vermeiden.
- Bleiben Sie beim Thema des zu kommentierenden Beitrags. Gehen Sie in Diskussionen mit Bloggern anderer Meinung auf deren Argumente ein und weichen Sie nicht durch Eröffnen laufend neuer Themen aus. Beschränken Sie sich auf eine zumutbare Anzahl von Kommentaren pro Zeit. Versuchte Majorisierung unseres Kommentarblogs, wie z.B. durch extrem häufiges Posten, permanente Wiederholungen etc. (Forentrolle) wird von uns mit Sperren beantwortet.
- Sie können anderer Meinung sein, aber vermeiden Sie persönliche Angriffe.
- Drohungen werden ernst genommen und ggf. an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben.
- Spam und Werbung sind im Kommentarbereich nicht erlaubt.
Diese Richtlinien sind sehr allgemein und können nicht jede mögliche Situation abdecken. Nehmen Sie deshalb bitte nicht an, dass das EIKE Management mit Ihnen übereinstimmt oder sonst Ihre Anmerkungen gutheißt. Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, Anmerkungen zu filtern oder zu löschen oder zu bestreiten und dies ganz allein nach unserem Gutdünken. Wenn Sie finden, dass Ihre Anmerkung unpassend gefiltert wurde, schicken Sie uns bitte eine Mail über "Über Uns->Kontakt"[15] Henry P. Scott, Russell J. Hemley et al. schreiben im Abstract:
„Wir präsentieren In-situ-Beobachtungen der Kohlenwasserstoffbildung durch Karbonatreduktion bei Druck und Temperatur im oberen Erdmantel. Methan wurde aus FeO, CaCO3-Calcit und Wasser bei Drücken zwischen 5 und 11 GPa und Temperaturen zwischen 500°C und 1.500°C gebildet. Die Ergebnisse stimmen mit mehrphasigen thermodynamischen Berechnungen überein, die auf der statistischen Mechanik von Weichpartikelmischungen basieren. Die Studie zeigt, dass es abiogene Wege für die Bildung von Kohlenwasserstoffen im Erdinneren gibt, und deutet darauf hin, dass der Kohlenwasserstoffhaushalt des Erdinneren größer sein könnte als bisher angenommen.“
Also „dass es abiogene Wege für die Bildung von Kohlenwasserstoffen im Erdinneren gibt„, somit die abiogene Bildung von Erdgas und Erdöl im Erdinneren aufgrund natürlicher Evolutionsprozesse! Also etwas, das der gängigen Theorie des Mainstreams total widerspricht, aber z. B. das Vorkommen von Methan-Seen auf dem Saturnmond Titan erklären kann.
Der Autor greift das oft diskutierte Stichwort „Atmosphärische Gegenstrahlung“ auf. Immerhin erfreulich, dass er deren Existenz nicht rundweg ablehnt. Dann kommt das oft genannte Argument: „Dass dies den Boden aufwärmen könnte, widerspricht eindeutig den Strahlungsgesetzen … Der wärmere Erdboden lässt sich nicht ohne Arbeit von der Strahlung eines kälteren Gegenstands erwärmen.“
Warum ist das so? Weil der wärmere Körper natürlich pro Fläche mehr abstrahlt, als er vom kälteren bekommt. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit! Denn die Hauptenergiequelle für den Erdboden ist die Sonnenenergie, die er absorbiert und die er dann wieder abstrahlen muß (soweit er sie nicht durch Konvektion oder Verdunstung los wird). Wenn er jetzt außer Sonnenstrahlung auch noch atmosphärische Gegenstrahlung wieder loswerden muß, muss er logischerweise mehr thermische Strahlung abgeben. Und dazu muss seine Temperatur steigen. So ist das gemeint mit der Erwärmung durch Gegenstrahlung. Man muss sich einfach die Energiebilanz am Boden anschauen, und die muss auf lange Sicht Null sein, sonst würde sein Temperaturniveau steigen oder fallen.
Die Gegenstrahlung allein kann natürlich einen warmen Boden nicht noch weiter erwärmen, aber Sonnenstrahlung plus Gegenstrahlung machen eine höhere Bodentemperatur als Sonnenstrahlung allein!
Glauben Sie denn, daß sich Strahlungsleistungen unterschiedlicher Quellen linear addieren? Noch dazu wenn eine eine quasi gerichtete und die andere eine hochdiffuse ist.
Vergleichen sie das mit zwei Heizkörpern, einer strahlt mit 60°C, der andere mit 0,5°C. Glauben Sie, wenn beide gemeinsam strahlen wird es wärmer als wenn nur der mit 60°C strahlt?
Wenn das mit der linearen Addition klappen würde, könnte man aus Tausenden mäßig hellen LEDs einen gleißend hellen Stadionscheinwerfer bauen. Halten Sie sowas für möglich?
Bei schräg einfallender Strahlung ist natürlich mit dem Sinus des Einfallswinkels zu gewichten, um den wirksamen Anteil zu ermitteln. Bei diffuser Strahlung ist dann aber noch über den Halbraum, also über alle Einfallsrichtungen zu integrieren. Ich setze voraus, daß das in den offiziellen Angaben zur Gegenstrahlung schon berücksichtigt ist.
Ihr Beispiel, Herr Strasser, mit 60 Grad und 0,5 Grad (Celsius) sieht schon weniger extrem aus, wenn man es in Kelvin ausdrückt: 333 K und 273,6 K. Der kältere Körper strahlt hier immer noch 45% des wärmeren ab. Außerdem ist der Temperaturunterschied zwischen Erdoberfläche und unterer Atmosphäre meist gar nicht so groß. In der Nacht tritt sogar oft Temperaturinversion überm Erdboden ein. Und die Gegenstrahlung, die die Erdoberfläche erreicht, stammt aus den unteren Schichten (eine Zahl für die mittlere freie Weglänge habe ich leider nicht parat, würde mich selber mal interessieren).
Ob man die Temperaturen in Kelvin oder °C ausdrückt, ist vollkommen gleichwertig. Es geht um den 2. HS.
Die Strahlung eines Heizkörpers mit z. B. 60°C erzeugt in einem Absorber in z. B. 30 cm Abstand eine gewisse Temperatur. Ein Heizkörper mit 0,5°C erzeugt eine geringere Temperatur (alles unter der Annahme, die Umgebungstemperatur wäre z. B. -5°C und es herrscht zuvor eingeschwungener Zustand, man kann sich das alles sogar im Vakuum vorstellen, um Wärmeleitung auszuschließen, alle Heizkörper gleich groß).
Wenn man jetzt beide zusammen strahlen läßt, erzeugt der 60°C Heizkörper die selbe Temperatur wie alleine, der zusätzliche 0,5°C Heizkörper erzeugt aber eine wesentlich geringere Temperatur, die in der des anderen bereits enthalten ist, sie also nie additiv übertreffen kann. Es wird also zuletzt der von 60°C erwärmte Absorber dem 0,5°C Heizkörper zustrahlen und diesen erwärmen ud nicht umgekehrt.
Der einzige Unterschied mit beiden Heizkörpern ist der, daß von -5°C bis zu der Temperatur, die der 0,5°C Heizkörper alleine erreicht, bei gemeinsamer Wirkung die Erwärmung schneller geht, als wenn nur der 60°C alleine strahlt. Ab dann, wird die geringere Energie einfach überdeckt, weil andernfalls Wärme von Kalt nach Warm fließen müßte.
Wegen der Geschwindigkeit und dem Wärmeverlust gibt es in größeren Räumen mehrere Heizkörper als in kleineren Räumen. Mit mehreren Heizkörpern wird es im Raum aber nicht wärmer, es geht nur schneller. Selbst wenn ich in einem Raum 100 Heizkörper mit 60°C betreibe, wird es nicht wärmer als max. 60°C. Real weniger, weil es nie eine 100% Isolation gibt, das thermische Gleichgewicht also unterhalb liegen wird.
Antwort 2. Teil
Natürlich kann man mit einem ‚Heizkörper‘ von 0,5 Grad kein Zimmer aufheizen, das schon bei 18 Grad liegt. Wenn das Zimmer aber -20 Grad hat, ist man vielleicht froh um diesen Heizkörper, v.a. wenn seine Fläche groß genug ist (z.B. Fußbodenheizung kommt mit geringen Vorlauftemperaturen aus).
Und zum Thema Stadionscheinwerfer aus Tausenden LEDs: im Prinzip möglich. Nur ist dieser Scheinwerfer dann auch über eine riesige Fläche verteilt. Aus diesem Grund wirkt die Lichtquelle selber nicht gleißend hell, aber die gewünschte Beleuchtungsstärke auf dem Platz wird trotzdem erreicht.
Damit sich Strahlungen theoretisch addieren könnten, wären zwei Bedingungen erforderlich. Zum einen müßte es sich um kohärente Strahlung/Licht handeln und zweitens müßten es Strahlen sein, die exakt ein und die selbe Richtung haben. Beides ist in der Realität nicht gegeben bzw. geometrisch garnicht möglich.
Es geht nicht darum, ‚Strahlungen‘ zu addieren. Sie meinen wahrscheinlich Wellen. Die müßte man natürlich phasenrichtig addieren.
Es geht aber sehr wohl darum, Energiebeiträge zu addieren, die von verschiedenen Quellen (auch Strahlungsquellen) geliefert werden. Und die Energieverluste zu subtrahieren, versteht sich. Es geht um Energie-Bilanzen.
Wenn ein Zimmer eine Temperatur von -20 Grad hat und der Fußboden 0,5 Grad, dann kühlt sich der Fußboden mittels Wärmeübertragung auf -19,xx Grad ab, und dafür steigt die Lufttemperatur auf die gleichen 19,xx Grad. hält man die Temperatur des Bodens mittels Bodenheizung konstant auf 0,5 Grad, erwärmt sich die untere Luftschicht mittels Wärmeübertragung und die restliche Luft mittels Konvektion, bis das Zimmer im Mittel 0,5 Grad erreicht.
Die Strahlung kann man dabei vernachlässigen, deren Einfluss auf die Temperaturänderung ist homöopatisch, kann man vernachlässigen. Bei den Wärmetauschprozesse an der Erdoberfläche auch.
Im Link #17 muß „/#respond“ weggelassen werden, dann funtioniert es.
Danke, ist korrigiert.
„Grenzen des Wachstums“
Was ist denn mit Wachstum gemeint?
Es gibt keine Grenzen für die weiter Entwicklung der Menschheit oder Gesellschaft. Damit sind wir eigentlich ständig im Wachstum.
Wir hören etwas von Ressourcenknappheit, Sparen oder sparsam Leben nur von den Linken und Grünen.
Dabei gibt es keine Knappheit an Lebensmittel, Wasser, der Ressourcen. Wenn es die nicht gibt, dann wird es von diesen Ideologen (Gläubigen) künstlich erzeugt, damit die Theorie halt stimmt.
Wir sollen sparsamer werden, weniger konsumieren, weniger werden (Bevölkerungsreduktion), damit wir mit diesen begrenzten Ressourcen überhaupt noch weiter oder gut leben können. Das ist die Mentalität der Linken und Grünen. War aber schon immer so. In der UDSSR war Luxus nicht erwünscht. Die Menschen sollten alle gleich arm bleiben. Nur so können diese Linken oder Grünen glücklich werden. Wenn alle arm sind.
„In der UDSSR war Luxus nicht erwünscht. Die Menschen sollten alle gleich arm bleiben.“ – da möchte ich widersprechen, Armut war nicht Staatsziel, Armut bzw. relative Armut im Sozialismus/Kommunismus/Totalitarismus/Links-Grün-Herrschaft ist das unvermeidbare Systemergebnis von Planwirtschaften.
„Armut war nicht Staatsziel, Armut bzw. relative Armut im Sozialismus/Kommunismus/Totalitarismus/Links-Grün-Herrschaft ist das unvermeidbare Systemergebnis von Planwirtschaften.“
Ja aber wenn das Ergebnis seit Jahrzehnten gleich ist und Sozialismus/Kommunismus zu Armut führt, dann kann das ja nicht irgendwie unbeabsichtigt sein. Da stimmt doch irgendwas nicht. Anscheinend stört es auch einige Leute, wenn es den Menschen zu gut geht ohne Krisen. Eventuell deswegen müssen irgendwelche Krisen erfunden werden wie Pandemie, Klimakatastrophe, Ressourcenknappheit. Ist anscheinend sonst zu langweilig.
Genau so ist es. Es kommt aber dazu, dass im „rael existiertenden Sozialismus“ vor allem unfähige Leute das sagen hatten. Irgendwie bekomme ich da die Kurve zu Prof. Kemfert, Habeck …