Eine kürzlich in Science Advances veröffentlichte Studie trägt den vielsagenden Titel „Eine große Hitzewelle im Nordatlantik hatte weitreichende und dauerhafte Auswirkungen auf das Leben im Meer“. Die Formulierung ist vorsichtig, aber eindeutig. Es wird ein einzelnes physikalisches Ereignis beschrieben, dessen ökologische Folgen als weitreichend und dauerhaft dargestellt werden. Für Leser, die mit der Literatur zum Thema Klima-Ökologie vertraut sind, ist die Schlussfolgerung klar: Es kam zu einer extremen klimatischen Anomalie, die Ökosysteme reagierten darauf, und der Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen ist hinreichend belegt, um Vertrauen zu rechtfertigen.
Die Arbeit versteht sich sowohl als Synthese als auch als Analyse. Sie fasst physikalische Temperaturaufzeichnungen zusammen, untersucht eine Vielzahl ökologischer Indikatoren und kommt zu dem Schluss, dass das Jahr 2003 einen Wendepunkt darstellt – eine thermische Störung, die das maritime Ökosystem des Nordatlantiks neu organisiert hat. Das Ziel ist nicht bescheiden. Die Autoren katalogisieren nicht nur Beobachtungen, sondern entwickeln eine kausale Erzählung.
Zu Beginn der Arbeit wird die zentrale Prämisse klar formuliert:
„Hier untersuchen wir, ob dieser plötzliche und starke Temperaturanstieg als MHW einzustufen ist, untersuchen die physikalischen Ursachen dafür und untersuchen seine Auswirkungen auf maritime Ökosysteme.“
[MHW = Major Heat Wave. A. d. Übers.]
Dieser Satz leistet viel. Er behauptet die Existenz eines „plötzlichen und starken Anstiegs“, geht davon aus, dass die Einstufung als maritime Hitzewelle sinnvoll ist, und geht dann direkt zu den Auswirkungen über. Was er nicht tut, ist innehalten und fragen, ob die miteinander in Verbindung stehenden Größen – „die MHW“ und „maritime Ökosysteme“ – präzise genug definiert sind, um eine kausale Schlussfolgerung zu stützen. Diese Auslassung ist kein Zufall, sondern zieht sich durch die gesamte Arbeit.
Die erste Schwachstelle ist die maritime Hitzewelle selbst. Trotz der starken Konnotationen des Begriffs identifiziert die Studie keine einzelnen Hitzewellen-Ereignisse im Ozean in einem physikalisch intuitiven Sinne. Stattdessen wird eine Metrik auf der Grundlage von Schwellenwertüberschreitungen konstruiert. Temperaturen über dem 99. Perzentil eines historischen Referenzzeitraums werden über 88 verschiedene Zeitreihen hinweg gezählt und nach Jahren summiert. Das resultierende Aggregat wird als „MHW-Häufigkeit” bezeichnet.
Die Autoren beschreiben dies wie folgt:
„Wir definieren eine MHW als jede Temperatur, die über dem 99. Perzentil des Referenzzeitraums 1870–1969 liegt, und zählen die Anzahl der MHWs pro Jahr.“
Hier werden nicht Ereignisse gezählt, sondern Überschreitungen. Eine einzige Wärmeanomalie im gesamten Einzugsgebiet kann diese Zahl dramatisch in die Höhe treiben, wenn viele korrelierte Standorte gleichzeitig ihre Schwellenwerte überschreiten. Die Metrik reagiert daher nicht nur empfindlich auf die Temperatur, sondern auch auf die räumliche Abdeckung, die Datendichte und die Korrelationsstruktur. Die Bezeichnung „Häufigkeit“ suggeriert eine Zählung unabhängiger Vorkommnisse. Das ist jedoch nicht das Ergebnis dieses Verfahrens.
Dies ist wichtig, da Häufigkeit Wiederholung, Wiederkehr und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen impliziert. Was die Studie jedoch tatsächlich verfolgt, ist die räumliche Kohärenz der Wärme im Verhältnis zu einem ausgewählten Perzentil. Ein Jahr mit einer allgemeinen Erwärmung sieht aus wie viele Hitzewellen, auch wenn es sich physikalisch um ein einziges Phänomen handelt. Diese Unterscheidung wird im Verlauf der Darstellung verwischt und schließlich vergessen.
Die Konstruktion wird noch problematischer, wenn man die Temperaturdaten selbst untersucht. Die Studie kombiniert gerasterte Gebiete der Meerestemperatur mit punktbasierten Beobachtungen in einer Tiefe von etwa 100 Metern. Dies sind keine austauschbaren Messgrößen für „Hitze”. Sie reagieren auf unterschiedliche Prozesse, wirken auf unterschiedlichen Zeitskalen und interagieren unterschiedlich mit biologischen Systemen. Dennoch werden sie als gleichwertige Faktoren für einen einzigen Index behandelt.
Die ökologische Seite der Bilanz ist noch weniger klar definiert. Der Artikel bezieht sich wiederholt auf „Auswirkungen auf das Ökosystem“, „abrupte Veränderungen“ und „weit verbreitete Reaktionen“ und vermittelt damit den Eindruck einer gut etablierten Basislinie, von der aus Abweichungen gemessen werden können. In Wirklichkeit ist die Basislinie eine Zusammenstellung unterschiedlicher Beobachtungen aus inkompatiblen Quellen.
Die Studie selbst deutet auf diese Breite hin:
„Die Belege für Veränderungen im Ökosystem wurden aus einer Vielzahl von begutachteten Publikationen und Bestandsbewertungsberichten zusammengestellt, die mehrere trophische Ebenen umfassen.“
Diese Breite wird als Stärke dargestellt. Aber Breite ohne Standardisierung führt nicht zu einer Basislinie, sondern zu einem Mosaik. Bewertungen der Fischbestände, Planktonindizes, benthische Untersuchungen und fischereibezogene Daten unterliegen alle unterschiedlichen Annahmen, Stichprobenstrategien und menschlichen Einflüssen. Jede hat ihren eigenen impliziten Referenzzeitraum, der sich oft im Laufe der Zeit verschiebt. Die Studie gleicht diese Unterschiede nicht aus. Sie richtet sie zeitlich aufeinander aus und behandelt Übereinstimmung als Kohärenz.
Viele der beschriebenen Veränderungen sind qualitative Beurteilungen, die durch Wiederholung hervorgehoben werden. Begriffe wie „abrupt“, „plötzlich“ und „ausgeprägt“ tauchen in der zitierten Literatur immer wieder auf, doch formale Tests anhand von Nullmodellen der natürlichen Variabilität sind selten. Eine Veränderung, die innerhalb eines kurzen Beobachtungszeitraums auffällig erscheint, wird implizit als außergewöhnlich behandelt, obwohl der historische Rahmen der Variabilität nur unzureichend definiert ist.
Das Problem wird durch den retrospektiven Charakter vieler ökologischer Basislinien noch verschärft. Die „Ausbreitung“ von Arten wird oft eher aus der ersten Entdeckung als aus der systematischen Abwesenheit abgeleitet. Veränderungen in der Häufigkeit werden aus verbesserten Erhebungen im Vergleich zu früheren, weniger zuverlässigen Daten abgeleitet. Sobald ein Ereignis wie das von 2003 als klimatisch bemerkenswert identifiziert wird, werden ökologische Beobachtungen natürlich in seinem Schatten neu interpretiert.
Der Artikel stützt sich ausdrücklich auf diese Übereinstimmung:
„Die MHW von 2003 fiel mit abrupten Veränderungen des Ökosystems auf mehreren trophischen Ebenen zusammen.“
Zufälle spielen hier eine große Rolle. Zeitliche Überschneidungen werden als erklärend angesehen, obwohl die Zusammenhänge zwischen einer Temperaturabweichung auf Beckenebene und verschiedenen ökologischen Reaktionen nicht eindeutig nachgewiesen sind. Fischereidruck, regulatorische Änderungen, Neugestaltung von Erhebungen und Marktdynamik – alles Faktoren, die maritime Daten maßgeblich beeinflussen – werden nur am Rande erwähnt.
Nirgendwo wird dies deutlicher als bei der Behandlung von Fischereidaten. Bestandsveränderungen und Schwankungen der Bestandsgröße werden als ökologische Reaktionen dargestellt, obwohl Fischereisysteme zutiefst sozioökologisch geprägt sind. Änderungen bei Quoten, Fangstrategien und Ortungstechnologien können zu „abrupten” Verschiebungen in den gemeldeten Bestandsverteilungen führen, ohne dass eine biologische Umstrukturierung zugrunde liegt. Die Basislinie geht stillschweigend davon aus, dass die Fischereiproduktion die ökologische Realität reflektiert und nicht das menschliche Verhalten, das sich auf die Ökosysteme auswirkt.
Der Artikel geht noch weiter und verwendet Begriffe aus dem Bereich des Regimewechsels, die starke kausale Implikationen haben:
„Die beobachteten Veränderungen stimmen mit den Merkmalen von Regimewechseln überein, die zuvor in maritimen Ökosystemen festgestellt wurden.“
Es wird jedoch keine formale Erkennung von Regimewechseln durchgeführt. Es gibt keine Change-Point-Analyse, keine Zustandsraummodellierung, keinen statistischen Nachweis dafür, dass 2003 einen strukturellen Bruch darstellt und nicht nur einen auffälligen Punkt in einem verrauschten, sich entwickelnden System. Die Übereinstimmung mit einer Regimewechsel-Erzählung wird behauptet, aber nicht nachgewiesen.
Der vielleicht aufschlussreichste Moment kommt, wenn die Autoren eine Spannung anerkennen, die sie nicht auflösen. Spätere Zeiträume weisen ähnlich hohe Werte der Hitzewellenmetrik auf, doch die ökologischen Reaktionen scheinen weniger dramatisch oder weniger gut dokumentiert zu sein. Die Arbeit nimmt dies zur Kenntnis und fährt dann fort. Diese Beobachtung untergräbt jedoch die zentrale Behauptung. Wenn der gleiche „Antrieb“ zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, ist entweder der Antrieb nicht gut charakterisiert oder er ist nicht der dominierende Treiber.
An keiner Stelle wird in der Studie ernsthaft die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass die Basislinie selbst instabil ist. Die Ökosysteme des Nordatlantiks befanden sich vor 2003 nicht im Gleichgewicht. Sie reagierten bereits auf jahrzehntelangen Fischereidruck, Nährstoffveränderungen und Schwankungen in der Zirkulation. Das späte 20. Jahrhundert als stabilen Referenzzustand zu betrachten, ist eine narrative Bequemlichkeit, keine feststehende Tatsache.
Letztendlich bietet die Studie eine fesselnde Geschichte, aber keine stringente kausale Argumentation. Eine locker definierte maritime Hitzewelle wird mit einer locker definierten ökologischen Basislinie gepaart, und beide werden durch zeitliche Koinzidenz und selbstbewusste Sprache miteinander verbunden. Die Synthese wirkt objektiv, weil sie umfangreich und umfassend ist, nicht weil ihre Grundlagen sicher sind.
Was als Beweis für einen Kausalzusammenhang präsentiert wird, lässt sich besser als Plausibilität verstehen, die in eine Erzählung eingebettet ist. Diese Unterscheidung ist wichtig. Wenn schwach konstruierte Größen starke Behauptungen stützen dürfen, wird die Unsicherheit nicht verringert, sondern verschleiert.
Die Gefahr besteht nicht darin, dass dieser Artikel allein übertrieben ist. Die Gefahr besteht darin, dass diese Art der Argumentation zum Standard wird: Korrelation wird als Kausalität dargestellt, Basiswerte werden eher abgeleitet als festgelegt, und Skepsis wird durch Anhäufung ersetzt. So werden komplexe Systeme nicht verstanden. So werden Geschichten zu Doktrinen.
Link: https://wattsupwiththat.com/2026/01/02/when-everything-is-a-heat-wave-and-every-change-is-climate/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE


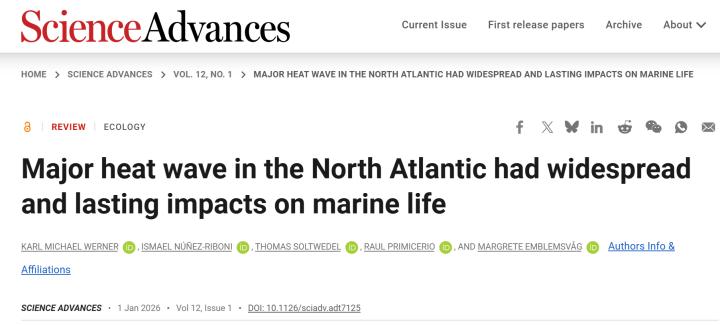



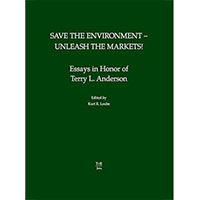

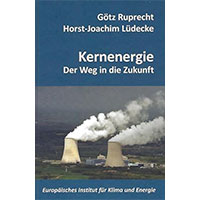
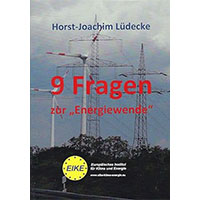


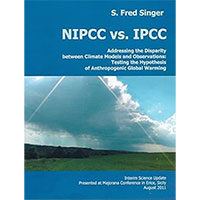




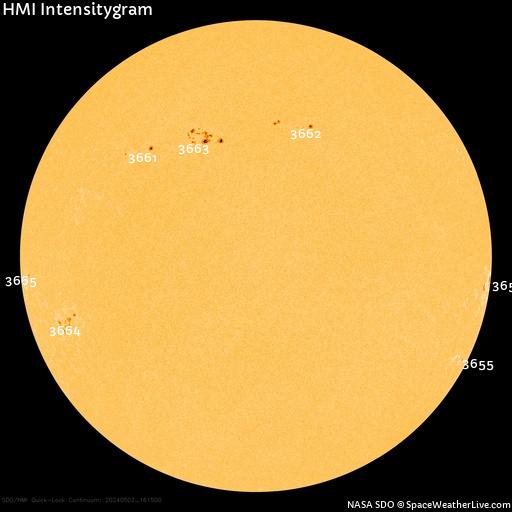
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
- Bitte geben Sie Ihren Namen an (Benutzerprofil) - Kommentare "von anonym" werden gelöscht.
- Vermeiden Sie Allgemeinplätze, Beleidigungen oder Fäkal- Sprache, es sei denn, dass sie in einem notwendigen Zitat enthalten oder für die Anmerkung wichtig sind. Vermeiden Sie Schmähreden, andauernde Wiederholungen und jede Form von Mißachtung von Gegnern. Auch lange Präsentationen von Amateur-Theorien bitten wir zu vermeiden.
- Bleiben Sie beim Thema des zu kommentierenden Beitrags. Gehen Sie in Diskussionen mit Bloggern anderer Meinung auf deren Argumente ein und weichen Sie nicht durch Eröffnen laufend neuer Themen aus. Beschränken Sie sich auf eine zumutbare Anzahl von Kommentaren pro Zeit. Versuchte Majorisierung unseres Kommentarblogs, wie z.B. durch extrem häufiges Posten, permanente Wiederholungen etc. (Forentrolle) wird von uns mit Sperren beantwortet.
- Sie können anderer Meinung sein, aber vermeiden Sie persönliche Angriffe.
- Drohungen werden ernst genommen und ggf. an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben.
- Spam und Werbung sind im Kommentarbereich nicht erlaubt.
Diese Richtlinien sind sehr allgemein und können nicht jede mögliche Situation abdecken. Nehmen Sie deshalb bitte nicht an, dass das EIKE Management mit Ihnen übereinstimmt oder sonst Ihre Anmerkungen gutheißt. Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, Anmerkungen zu filtern oder zu löschen oder zu bestreiten und dies ganz allein nach unserem Gutdünken. Wenn Sie finden, dass Ihre Anmerkung unpassend gefiltert wurde, schicken Sie uns bitte eine Mail über "Über Uns->Kontakt"Man stelle sich das CO2-Molekül als Wesen vor , dass eine Armbrust hat. Dann müssten 4 CO2-Moleküle mehr Pfeil-Schuss-Energie ( Bewegung ) in seine Umgebung abgeben wie 99996 andere Luftmoleküle dies per Kollision und / oder Strahlung können : es ergibt sich kein sichtbares Ergebnis auf der makroskopischen Ebene.
Die IR-Spektroskopie ist für die qualitative und quantitative kontakfreie Analyse entwickelt worden und nicht um uns Menschen hinter die Fichte zu führen mittels einer magischen Maschine ( URAS ultrarot Absorptionsschreiber )
Mit 4 Rosen kann ein Kavalier nichts gegenüber einem Kavalier bewirken , der 999996 Rosen per Flugzeug „regnen“ lässt. Oder vielleicht doch. Ist eventuell nicht der passende Vergleich : bitte gerne um bessere Vergleiche.
Erwärmung bedeutet , daß Teilchen sich im Durchschnitt schneller bewegen wenn ihnen Energie zugeführt wird und sie diese zusätzliche Energie für die Fortbewegung nutzen. Sie speichern die zugeführte Energie als Bewegungsenergie . Die Bewegungsenergie kann danach in andere Energieformen umgewandelt werden.
Bei der Emission eines Quantes wird aber die zuvor aufgenommene Energie Delta x nicht in kinetische Energie umgewandelt. Sie wird sofort nach der Absorption emittiert , so daß es zu keiner Energieumwandlung kommen kann. Das frei und materielos swiftende Quant transportiert die emittierte Energie durch die Luftschicht über dem Meer. Es erfolgt aber keine Erwärmung , weil die Gasmoleküle in dieser Luftschicht nicht beschleunigt werden. Dazu reicht die Kapazität an CO2 , H2O , CH4 etc nicht aus. 430 ppm CO2 können in Bezug zur Meeresoberfläche nur einen Bruchteil der Gasmoleküle um sich herum per Kollision beschleunigen. Ein CO2-Molekül müsste 999994 andere Moleküle beschleunigen. Also wie ein Fön wirken. Oder wie ein XXXL-starker Heizstab in der Nordsee.
Ohne zusätzliche Energiequelle im Meer kann sich dieses nicht mehr als durch die Sonnenstrahlenenergie erwärmen. Ohne kontinuierliche Energiezufuhr ist auch ein „klimabedintes Hochwasser“ unrealistisch.
Da weder gigantische Luftföngeräte noch gigantische Heizstäbe in der Nordsee vorhanden sein können , bleibt es bei den von den verschiedenen maritimen Organisationen gemessenen Temperaturdaten. Diese vorhandenen Daten sollten der Gegensstrahl-Hypothese gegenüber gestellt werden.Auch im MSC Maritimen Sicherheits Centrum dürften alle Daten vorhanden sein. Der Weltschifffahrtsweg ist prädesteniert dazu das Gehenstrahl-Konstrukt zu entlarven :
“ Heiße Luft bleibt heiße Luft“ ohne Energiezufuhr erfolgt keine weitere Erwärmung ( Heissluftballon , Fön , Heizstab …., Kollision mit schnelleren Molekülen… ).
Die Gegenstrahlung ist :
1. physikalischer Unsinn
2. mikroskopische Beschreibung einer Absorption & Emission von Energiequanten ohne jemals ein makroskopisch beobbachtbarer Energiestrahl zu werden
3. eigentlich = 1. : wir allesamt werden bewußt für dumm verkauft indem sich nicht an die Fachsprache der Physik hält ( ein Strahl mit Millionen von Quanten ist makroskopisch messtechnisch ermittelbar .Ei n Quant ist kein „Millionenstrahl “ )
Im Hafen von Cuxhaven werden derzeit Spundwände eingerammt um aus der Tidenhub Bewegungs-Energie Strom zu erzeugen.
Hier sei einmal auf Makroskopische und Mikroskopische Effekte hin gewiesen. Wärmeinseln , wie von Herrn Kowatsch und Herrn Barritz beschieben sind ganz klar makropische Effekte . Die von CO2 oder H2O emittierten Quanten ( Photonen ) verfügen über eine Masse und eine Frequenz. Sie sind Beobachtungsobjekte auf der mikroskopischen Ebene.
Werden nun von den Befürwortern der „Gegenstrahl-Hypothese“ die wordings der mikroskopischen Ebene ungefiltert / unadapiert für die makroskopische Ebene benutzt , hat dies ein Geschmäckle. Ein gequanteltes Energieteilchen ist kein Quantenstrahl. Somit ist der Begriff Gegenstrahlung unsinnig , wenn man auf der physikalischen Ebene bleibt.
Wenn da nicht der Gedanke an Lob , Orden , Geld , berufliche Zwänge , nette Einladungen zu Dinnerangelegenheiten etc wären.
Gäbe es eine Gegenstrahlung , dann würde sich das Meer stets selbst rückerwärmen . Die vom Meer emittierten Frequenzen würden auf ihrem Weg zum Horizont einen Teil ihrer Energie zurück in Richtung Meer senden. Beobachtet wird aber nur die mikroskopische Anteil von jeweils nur einem Quant , welches aber nie auf der Meeresoberfläche ankommt , da die millionenfach anwesenden Lufteilchen dieses Quant unmittelbar nach Aussendung absorbieten.
um den Tidenhub auf mehrere m anzuheben müsste es ein gewaltiges Etwas an wärmeenergie Spendentes geben. Solch eine gigantische Wärmeinsel gibt es aber nirgendwo .
Die Deichverbände und die zuständigen Deichschutzämter in Deutschland haben einen guten Datenschatz an in echt Zeit gemessenen Daten der Nordsee , der Weser und der Elbe. ECHTE DATEN . Keine Projektionen.
Kleine, aber wichtige Korrektur Frau Vooth: Photonen besitzen nicht die Eigenschaft Masse! Sie unterscheiden völlig richtig makroskopische und Quanteneffekte. Genau deshalb kann man die oft in entsprechenden Herleitungen zu findenden Gleichsetzungen von E = h * f und E = m * c^2 nicht benutzen, da diesen zwei völlig unterschiedliche Modelle zugrunde liegen – das eine Modell behandelt die Eigenschaften massebehafteter Körper, das andere beschreibt die Eigenschaften von Photonen oder auch Phononen.
Genau deshalb sollte man meiner Ansicht nach auch nicht versuchen, Eigenschaften der Atmosphäre – als makroskopisches Objekt – mit quantenphysikalischen Effekten zu erklären. Die Zunahme an CO2 in der Atmosphäre führt zu einer Zunahme der Wärmekapazität selbiger – dies lässt sich quantenphysikalisch erklären. Alle nachfolgenden Effekte sind dann auf diese erhöhte Wärmekapazität zurückführbar – beschrieben durch die klassische Thermodynamik und kinetische Gastheorie.
Herr Gregor, sie sagen:
Die eigentlichen Zahlen, mit der Annahme, das wir Sauerstoff verbrennen und mit CO2 ersetzen:
Demnach, rein von den Zahlen, verringert sich die Waermekapazitaet, je mehr CO2 in der Atmosphaere ist.
Was genau ist die quantenphysikalisch scheinbar gegenteilige Erklaerung?
Lieber Herr Schulz,
Sie haben natürlich völlig recht, ich hatte tatsächlich andere Werte für die Wärmekapazitäten in Erinnerung. Damit kann man dies natürlich auch nicht quantenphysikalisch begründen.
Der quantenphysikalische Beitrag des CO2 besteht meiner Ansicht nach durch die zusätzliche Wärmeübertragung vom Erdboden in die Atmosphäre über die zusätzliche Absorption im 15-Mikrometer-Band.
Kein Problem, die Zahlen kommen von der KI.
Diese meinte sogar die Wärmekapazität von CO2 ist Größer.
Obwohl die Zahlen da standen.
Als ich nach der Quelle fragte kamen Links, einer veraltet, nicht existent, der andere zeigt nicht die Daten.
Mittlerweile denke ich sie könnten trotzdem recht haben, müsste dann aber ein Buch befragen.
Die Zahlen für Luft und Stickstoff sind wenigstens mit Link belegt.
Wo wir mit der KI noch hinkommen, ist echt ne Frage….
Hier ein Link mit Zahlen.
👍
In der Nähe der “ Alten Liebe“ ( Standort der Fotoaufnahme höchst wahrscheinlich ) gibt es die Wettermessstation Cuxhaven. Nahe der Elbe und dem Hafenbecken und an eine gut befahrenen Straße ( „Autoabwärme „). Um festtstellen zu können , ob es auf dem Meer wärmer wird , müsste man deshalb eher die Daten der Plattform Mittelplate analysieren. Auch soll es eine unabhängige Boye in der Nordsee selbst geben , die verschiedene Parameter 24/7 misst.
Ein weites Feld der outdoor physikalischen Messdaten-Erhebung. Diese würde sich sicherlich über entsprechende Fördermittel freuen. Immerhin könnte man im Fördermittelantrag darauf vetweisen , dass es validierende Messdaten der Staatlichen Seefahrtsschule , der Bundeswehr , der zivilen und der militärischen Schifffahrt und Sateliten-Messreihen gibt. Wenn dann bis 2035 kein Beleg für eine dramatische Erwärmung der Nordsee gemessen wurde , dürfte es Zeit für einen Paradigmenwechsel sein. Kein Drama-Weltuntergang , sondern Meeresspiegel-Höhe es usual.
Es wird keine „karibik“-ähnliche Wärmeinsel von riesigen Ausmass gefunden werden , die soviel Wärmepower in die Nordsee abgeben könnte.
Zeigt das Foto die Elbe vor Cuxhaven ? Dann ist dieser Bereich noch nicht das „Meer“ ( = Nordsee ) sondern die Elbmündung kurz vor Mündung in die Nordsee.
Glauben Sie, dass die Autoren der Studie wirklich die tatsächlichen Auswirkungen gelegentlicher Naturphänomene auf das Ökosystem ermitteln wollten oder lediglich ihre eigene Meinung bestätigen wollten? Ich habe derzeit Schwierigkeiten, ein Buch zu lesen (P. Giordano „Tasmanien“), dessen Helden europäische Intellektuelle sind, die von der Angst vor einer kochender Erde besessen sind – und die ihre Angst wissenschaftlich begründen versuchen..
Sogar der ÖRR sendet jetzt schon Sachen, die sind „erstaunlich“.
Sendung über Grönland. Es wächst kein einziger Baum. Aber, aufgrund der Erwärmung wird ein schmaler Küstenstreifen immer grüner. Und die Einheimischen können bald wieder Gemüse anbauen wie zu Zeiten der Wikinger. Was, Grünland war schon mal wärmer. Es wuchsen Obst, Gemüse und Bäume. Also sowas aber auch. Und wir haben diese Katastrophe scheinbar dann auch noch ganz knapp überlebt. Und jetzt wiederholt sich dieser schrecklich Zustand auch noch. 😉
Leicht anderes Thema
Vor 20 Jahren gab es mal was, da gab es viel Schnee, Kälte und den Dacheinsturz in Bad Reichenhall https://de.wikipedia.org/wiki/Eislauf-_und_Schwimmhalle_Bad_Reichenhall
Heute haben wir viel Schnee, Kälte und warten auf noch einen Dacheinsturz. Genau vor 20 Jahren, zur gleichen Zeit, ein gleichartiges Wetter? Aber wir haben doch „Klima“, da muß es doch viel, viel wärmer geworden sein, weil wir doch ständig „Rekordtemperaturen“ haben und Sonnenzyklen / Wetterzyklen gibt es doch nicht …
Hier, 100km südlich von Paris, auch schon 8 cm Schnee und es schneit weiter.
Hatte man uns nicht vorhergesagt das es keinen Schnee mehr geben würde?
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/winter-ade-nie-wieder-schnee-a-71456.html
Und der historische Winter hat erst vor 2 Wochen begonnen.
Im Moment geben sich hier bei uns die Kipppunkte mit Minuszeichen aus Potsdam die Klinke in die Hand. Laut t-online erwartet uns jetzt ein Schneeorkan und Hitzewellen, ob an Land oder im Meer, sind (noch) nicht zu erkennen. Aber 2025 haben uns nach den Fachleuten des AWI marine Hitzewellen schon in der Kieler oder Flensburger Förde bereits im April und Mai erwischt. Meine Augenbrauen zogen sich damals bis weit gen Himmel und ich musste mich in einem ersten Reflex mit der Definition von „Hitze“ im Meer beschäftigen. Da kann man auf Wikipedia folgendes lesen: Eine marine Hitzewelle (MHW), auch Meereshitzewelle, ist eine relativ lange Zeitspanne ungewöhnlich hoher Meerestemperaturen in einer Region. Nach einer 2016 vorgeschlagenen konkreteren Definition spricht man von einer marinen Hitzewelle, wenn über einen Zeitraum von mindestens fünf Tagen die Temperaturen höher sind als 90 % der Temperaturwerte, die in einem 30-jährigen Vergleichszeitraum für die gleichen Kalendertage und die Region ermittelt wurden.
Gut das es an Land keine marinen Hitzewellen gibt, denn terrestrische Hitzewellen mit ähnlicher Definition würden die humanoiden Landsäuger mit normaler Geistesstruktur veranlassen, den Klimatologen eine psychotherapeutische Entspannungskur zur Verbesserung des Wohlbefindens vorzuschlagen, natürlich unter begrenzter Berücksichtigung der Hitze-Leitlinien von Professor Karl Lauterbach, der als Gesundheitsminister bekanntlich auch Hitzewellen direkt an der Bodenoberfläche als prämortale Ereignisse würdigte. Ich kann mich nicht entsinnen, jemals „Hitze“ in „Wellen“ zwischen November, über Rosenmontag bis Ostern erlebt zu haben. Aber in meiner Jugend kannte man überhaupt „Hitze“ nur dann, wenn der Schulleiter mit seinem Thermometer an einer schattigen Stelle auf dem Schulhof morgens um 10 Uhr eine ministerial vorgegebene Außentemperatur ermittelte. Dann gab’s hitzefrei und jeder wusste was „Hitze“ war und wie sich das anfühlt. Die „Welle“ interessierte damals niemanden, weil fünf Tage in Folge es sowieso nie hitzefrei gab. Heute machen uns die Metereologen in der Klimakrise Angst durch definierte „Sommertage“ oder „Tropennächte“, wobei allerdings die überwiegende Zahl der Landsleute deshalb nur sehr begrenzt Angstzustände entwickeln. Wird es mit der Wärme ganz schlimm, kann man noch immer auf die Balearen fliehen.
Nochmal zurück ins Meer. Ich bin zunächst ganz beruhigt das es marine Hitze erst seit 2016 gibt, also in der Hochphase der Klimaapokalypse. Ich habe also wirklich nichts verpasst und auch nicht Jahrzehnte unwissend und ohne Hitzewallungen hinterm Mond gelebt.