In juristischen Fachkreisen wurde das Urteil äußerst zwiespältig aufgenommen. Von Klimaaktivisten und „Umweltschutzverbänden“ wurde es bejubelt.
Möglicherweise ein gefährliches zweischneidiges Schwert, welches die Demokratie gefährdet.
Ich habe von einer KI dieses Urteil analysieren lassen. Welche Dokumente habe ich für die Analyse verwendet?
Die Analyse habe ich von ChatGpt, Gemini und Deepseek durchführen lassen.
Vorbemerkung, eine KI ist nicht wirklich intelligent. Eine KI ist ein Datenanalysetool. Und das kann die KI sehr gut.
Nun hier das Ergebnis der befragten KIs zur Frage im Titel dieses Beitrags.
Die Pressemitteilung Nr. 31/2021 des Bundesverfassungsgerichts vom 29. April 2021 befasst sich mit den Verfassungsbeschwerden gegen das Klimaschutzgesetz (KSG) und erklärt diese teilweise für erfolgreich. Das Gericht stellt fest, dass die Regelungen des KSG für die Zeit nach 2030 unzureichend sind und fordert den Gesetzgeber auf, bis zum 31. Dezember 2022 detailliertere Bestimmungen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen für die Zeiträume nach 2030 zu erlassen.
Kritische Analyse:
-
Verfassungsrechtliche Verankerung des Klimaschutzes: Das Bundesverfassungsgericht leitet aus Artikel 20a des Grundgesetzes eine staatliche Verpflichtung zum Klimaschutz ab. Diese Interpretation betont die Bedeutung des Umweltschutzes als Staatsziel. Allerdings könnte argumentiert werden, dass das Gericht hier eine aktive Rolle in der politischen Willensbildung übernimmt, die traditionell dem Gesetzgeber vorbehalten ist. Die richterliche Konkretisierung von Staatszielen könnte als Überschreitung der judikativen Kompetenzen kritisiert werden.
-
Intertemporale Freiheitssicherung: Das Gericht betont, dass die aktuellen Regelungen des KSG zukünftige Generationen unverhältnismäßig belasten könnten, da notwendige Emissionsreduktionen in die Zukunft verschoben werden. Diese Argumentation der „intertemporalen Freiheitssicherung“ ist innovativ, wirft jedoch Fragen auf:
- Justiziabilität: Inwieweit können potenzielle zukünftige Freiheitsbeschränkungen heute justiziabel gemacht werden?
- Demokratische Legitimation: Durch die Vorgabe konkreter Handlungsziele für zukünftige Gesetzgeber könnte die demokratische Entscheidungsfindung zukünftiger Parlamente eingeschränkt werden.
-
Vorgabe konkreter Gesetzgebungsfristen: Die Anordnung an den Gesetzgeber, bis zum 31. Dezember 2022 detaillierte Regelungen für die Zeit nach 2030 zu treffen, stellt eine direkte Einflussnahme auf den legislativen Prozess dar. Dies könnte als Eingriff in die Gewaltenteilung interpretiert werden, da das Gericht hier nicht nur verfassungsrechtliche Mängel aufzeigt, sondern auch konkrete Fristen für deren Behebung setzt.
-
Fehlende Berücksichtigung internationaler Aspekte: Obwohl das Gericht das Pariser Abkommen als Referenz heranzieht, bleibt unklar, wie internationale Verpflichtungen und die globale Natur des Klimawandels in die nationale Gesetzgebung integriert werden sollen. Die alleinige Fokussierung auf nationale Maßnahmen könnte die Komplexität des globalen Problems unzureichend abbilden.
-
Praktikabilität und Umsetzbarkeit: Die Forderung nach konkreten Reduktionszielen und -pfaden erfordert detaillierte wissenschaftliche und ökonomische Analysen. Es ist fraglich, ob das Bundesverfassungsgericht die notwendige Expertise besitzt, um solche spezifischen Vorgaben zu machen, und ob diese in der Praxis umsetzbar sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Bundesverfassungsgericht mit diesem Beschluss Neuland betritt, indem es den Klimaschutz als verfassungsrechtliche Verpflichtung konkretisiert und zukünftige Gesetzgebungsprozesse beeinflusst. Dies wirft grundlegende Fragen zur Rolle des Gerichts, zur Gewaltenteilung und zur demokratischen Legitimation auf.
Ich bin kein Jurist, aber aus diesem Urteil kann man auf andere Schutzbedürftige hinweisen.
In dem Zusammenhang möchte ich noch auf ein anderes Urteil des BVerfg hinweisen. Das Flugzeugurteil.
Abschussermächtigung im Luftsicherheitsgesetz nichtig
§ 14 Abs. 3 Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG), der die Streitkräfte ermächtigt, Luftfahrzeuge, die als Tatwaffe gegen das Leben von Menschen eingesetzt werden sollen, abzuschießen, ist mit dem Grundgesetz unvereinbar und nichtig. Dies entschied der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts mit Urteil vom 15. Februar 2006. Für die Regelung fehle es bereits an einer Gesetzgebungsbefugnis des Bundes. Art. 35 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 GG, der den Einsatz der Streitkräfte bei der Bekämpfung von Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen regelt, erlaube dem Bund nicht einen Einsatz der Streitkräfte mit spezifisch militärischen Waffen.
Im Analysieren von Daten ist KI tauglich. KI ist ein Tool, man muss es nur richtig bedienen.
Ich bedanke mich für Deine Aufmerksamkeit und teile den Artikel bei X, Facebook u.a.



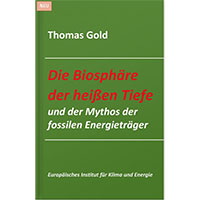
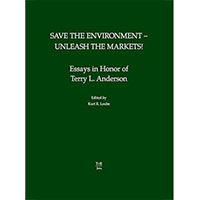
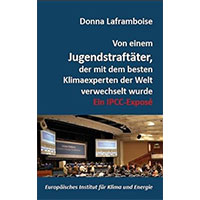
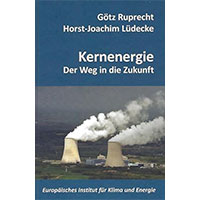
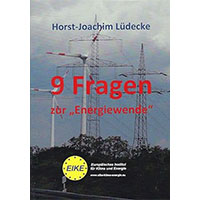
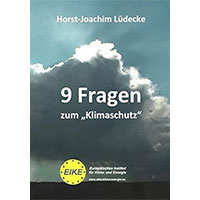
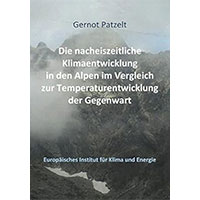
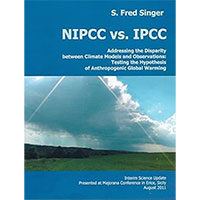
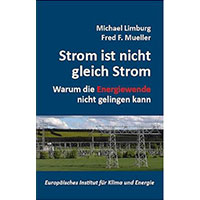
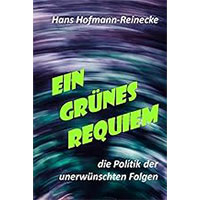


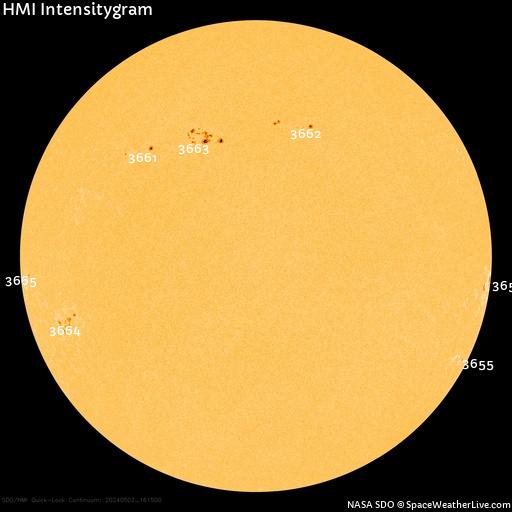
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
- Bitte geben Sie Ihren Namen an (Benutzerprofil) - Kommentare "von anonym" werden gelöscht.
- Vermeiden Sie Allgemeinplätze, Beleidigungen oder Fäkal- Sprache, es sei denn, dass sie in einem notwendigen Zitat enthalten oder für die Anmerkung wichtig sind. Vermeiden Sie Schmähreden, andauernde Wiederholungen und jede Form von Mißachtung von Gegnern. Auch lange Präsentationen von Amateur-Theorien bitten wir zu vermeiden.
- Bleiben Sie beim Thema des zu kommentierenden Beitrags. Gehen Sie in Diskussionen mit Bloggern anderer Meinung auf deren Argumente ein und weichen Sie nicht durch Eröffnen laufend neuer Themen aus. Beschränken Sie sich auf eine zumutbare Anzahl von Kommentaren pro Zeit. Versuchte Majorisierung unseres Kommentarblogs, wie z.B. durch extrem häufiges Posten, permanente Wiederholungen etc. (Forentrolle) wird von uns mit Sperren beantwortet.
- Sie können anderer Meinung sein, aber vermeiden Sie persönliche Angriffe.
- Drohungen werden ernst genommen und ggf. an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben.
- Spam und Werbung sind im Kommentarbereich nicht erlaubt.
Diese Richtlinien sind sehr allgemein und können nicht jede mögliche Situation abdecken. Nehmen Sie deshalb bitte nicht an, dass das EIKE Management mit Ihnen übereinstimmt oder sonst Ihre Anmerkungen gutheißt. Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, Anmerkungen zu filtern oder zu löschen oder zu bestreiten und dies ganz allein nach unserem Gutdünken. Wenn Sie finden, dass Ihre Anmerkung unpassend gefiltert wurde, schicken Sie uns bitte eine Mail über "Über Uns->Kontakt"Niemand interessiert dieser xxxxx xxxx
Bitte hier nur unter vollem Klarnamen posten. Und, halten Sie sich auch beim Text an die Regeln.
Schon der erste einleitende Satz im Beschluss: „Der Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG …“, zeigt aus meiner Sicht die Verkommenheit der/einiger Verfassungsrichter.
Dann gefolgt von „Art. 20a GG verpflichtet den Staat zum Klimaschutz.“! Wer ist eigentlich der Staat? Dieser Artikel ist eine Schande für das GG!
Werde mir diesen Beitrag merken, ich denke damit hat man einiges an Argumentationshilfen; auch im Hinblick auf den allgemeinen Zustand des Verfassungsgericht.
Gut gemacht, Michael. Und die KI hat eine Meinung und die ist nicht die schlechteste. Mich schockierte am Urteil auch, warum ausgerechnet eine federführende Richterin zur Sprecherin der Verfassungsgericht bestimmt wird, die privat in einer Beziehung mit einem Funktionär der Grünen lebt. Kommt man in diesem hohen Amt nicht selber zu der Entscheidung wegen der Interessenskonflikte sich gänzlich zurückzuziehen? Dazu braucht man keine KI, sondern gesunden Menschenverstand. Das Gericht hat keinerlei wissenschaftliche Abwägung vornehmen können, ob und wann ein sogenanntes Treibhausgas CO2 ein umweltschädigendes Molekül ist und wann es als Molekül des Lebens zu würdigen ist. Immerhin dürfte es geowissenschaftlich bei grober Schätzung als gesichert gelten, dass in der Evolution seit dem Erdmittelalter vermutlich in > 90 % der Zeit höhere CO2- Gehalte in der Atmosphäre vorlagen. Woraus leitet sich aus Sicht der Richter eine Bedrohung der Menschheit durch potenzielle Erwärmung des zukünftigen Klimas von 1,5-2 Grad Celsius über der vorindustriellen Referenz ab, wenn durch das gegenwärtige Klima global 8-10 mal mehr Menschen durch Kälte als durch Hitze versterben? Eine unterlassene Handlung politischer Entscheidungsträger oder Fahrlässigkeit im Klimaschutz für zukünftige Szenarien lassen sich nur mit fadenscheinigen Argumenten außerhalb der wissenschaftlichen Grundlagen ideologisch begründen. Sind das „unsere Werte“?
„Mich schockierte am Urteil auch, warum ausgerechnet eine federführende Richterin zur Sprecherin der Verfassungsgericht bestimmt wird, die privat in einer Beziehung mit einem Funktionär der Grünen lebt.“
Keine Gefahr auch diese Richter, wie auch die Regierung, haben doch einen Eid geschworen, oder?
Klingt richtig und vernünftig! Die KI kann in Jura jedenfalls mehr als ich. Jetzt fehlt nur noch den Beweis durch die KI, dass man die These vom anthropogenen CO2, das monokausal das Klima erwärmt, nicht beweisen kann – weder im Labor noch mit einer zweiten Erde. Nicht falsifizierbare Thesen reichen nicht aus, Dogmen erst recht nicht.
Moin Herr Dr. Ullrich, einen Beweis für den CO2-Unainn wird es nicht geben, wie auch der Gegenbeweis nicht geführt werden kann.
Aber was ich machen kann, die Klimawissenchaft als Pseudowissenchaft zu entlarven.
„Aber was ich machen kann, die Klimawissenchaft als Pseudowissenchaft zu entlarven.“
Auf denn! Es ist bis heute den wenigsten bewusst, Grünen schon gar nicht. Dass wir mit nicht-falsifizierbarer Pseudowissenschaft verdummt und ruiniert werden. Weil es die letzten Jahrzehnte etwas wärmer wurde, „muss“ es das anthropogene CO2 sein – erstes Dogma der Klimakirche.
Mein Geld wird immer weniger, was „beweist“, dass mein Geldbeutel ein Loch hat. Obwohl kein passendes Loch zu erkennen ist und es viele weitere Ursachen für den Geldschwund gibt.
In einigen Fragen (Klima, Corona, Demokratie, individuelle Freiheit, Parteieneinschätzung) hat sich das Bundesverfassungsgericht leider selbst ermächtigt die Rolle eines das Grundgesetz verletzenden politischen Wächterrates einzunehmen, dies ist Folge der Art und Weise der undemokratischen Besetzung der Posten in diesem Gericht nach Haltung und Quote, statt ausschließlich nach juristischer Eignung und Unparteilichkeit, durch die Blockpartiendiktatur, oder?
Moin Herr Lange, das ist auch meine Einschätzung.
+++
Der tschechische Ex-President Klaus hat schon vor 30 Jahren konstatiert, dass uns eine Richterkratie droht- und wir leben schon in einer…
genau und nicht genug
zig-tausende von „Neu-Juristen“ haben kaum anderes zu tun (nach Auswendiglernen)
an bestehenden Gesetzen etc herumzufummeln , bis es irgendwem irgendwie besser
passt ( vergleichbar mit Ingenieur-Studierenden die immer anderere Falt-Kartons
„basteln“ : wozu ? ) ……..EIN Problem ist : „Mutti´s“ : „Wir….Rechtsstaat“
nicht nur Steuerrecht kann und muss vereinfacht werden , sondern die gesamte
„Juristerei“ ……… ist nie für´s Volk sondern dagegen ……..
Nein, das kommt ihnen nur so vor – weil sie mit den Richtersrpüchen nicht zufrieden sind, zweifeln sie die zuständigkeit an. Klassiker!