von Dagmar Jestrzemski
Im Februar letzten Jahres nahm der mdr-Rundfunk die Frage eines Hörers auf, die wohl vielen Menschen unter den Nägeln brennt: Warum wird der nicht zutreffende Begriff „erneuerbare Energien“ für alternative Energiequellen wie Windkraft und Solarenergie angewendet? In der Tat ist der Begriff falsch. Die physikalischen Prozesse in der Erdatmosphäre sind sehr komplex, sie unterliegen jedoch alle den Gesetzen der Thermodynamik. Dies erweist schon die Anwendung des Energieerhaltungsgesetzes (1. Hauptsatz der Thermodynamik). Energie kann nicht erzeugt oder vernichtet werden, sondern lediglich von einer Form in eine andere umgewandelt werden. Die Bezeichnung erneuerbare Energien suggeriert demgegenüber Unbedenklichkeit hinsichtlich des Entzugs von Wind- und Sonnenenergie aus der Atmosphäre in beliebigem Umfang für unsere menschlichen Bedürfnisse. Mit der Frage des Hörers wandte sich ein Journalist des Senders an den Astronomen Sergei Klioner von der TU Dresden. Dieser bestätigte, dass der Begriff erneuerbare Energien fälschlicherweise unterstellt, entzogene Energie könne neu hergestellt werden. Das könne sie aber nicht. Energie kann bekanntlich nur (mit Reibungsverlust) umgewandelt werden. Fast alle Energie auf der Erde sei letztlich umgewandelte Strahlungsenergie der Sonne. Da sich die Sonnenstrahlung nicht verändere, wenn wir Energie für unsere Zwecke abzapfen, könne er aber mit dem Begriff erneuerbare Energien leben, erklärte er ausweichend. Aber wie ändern sich die Windverhältnisse und damit das Wetter, wenn der Mensch in dem Ausmaß, wie es geschieht, in die Dynamik der Atmosphäre eingreift und dabei die Windströmung schwächt? Dazu mochte sich der Professor offenbar nicht äußern. Denn es hängt mittlerweile viel, sehr viel von der fest zementierten Vorstellung ab, dass die für den Wind- und Solarstrom hierzulande und weltweit abgeschöpften atmosphärischen Kräfte „irgendwie erneuerbar“ seien. Nicht zuletzt betrifft das die Stabilität der Finanzmärkte. Fondsfirmen und Kapitalinvestoren haben Billionen Euro in Green und Climate Bonds (Grüne Anleihen) investiert, da sie durch positive Unternehmensbewertungen etwa durch die Brancheninitiative Net Zero Asset Managers (NZAM), die das Netto-Null – (CO2) Emissionsziel schon im Namen trägt, dazu bewogen wurden. Desgleichen beeinflusst die Climate Bonds Initiative (CBI) Anleger durch Zertifizierungen und berät Regierungen, damit diese per Gesetzgebung Steuermittel für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen einsetzen. Partner der CBI sind Banken, Anleger, Umweltverbände, Finanzdienstleister und Nichtregierungsorganisationen (NGOs).
Dann hat der MDR-Journalist noch eine Idee. Er fragt den Sprachwissenschaftler Markus Hartmann von der Universität Erfurt. Der weist auf die Historie des Begriffs und damit auf die richtige Spur hin. Der Begriff „renewable Energy“ sei bereits vor über hundert Jahren im englischsprachigen Raum in Gebrauch gewesen, erklärt Hartmann. Ein Blick in die Geschichte erhellt die veränderte Bedeutung des Begriffs im Laufe der Zeit.
Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts wurde das amerikanische Windrad zur Wasserförderung mit automatischer Geschwindigkeitsregelung angewendet, später auch zur Stromerzeugung mit Inselnetzsystem. Mit „renewable Energy“ war eine neue Technik gemeint, die jahrzehntelang wie die früheren Windmühlen ohne nennenswerten Entzug von Strömungsenergie aus der Atmosphäre funktionierte. In den 1930er Jahren bemühte man sich indes vergeblich, kinetische Energie zur Erzeugung elektrischer Energie in großem Maßstab wirtschaftlich nutzbar zu machen.
Seit 1974 arbeitete die US-Regierung gemeinsam mit Industrieunternehmen an der Weiterentwicklung der Stromerzeugung mittels abgeschöpfter kinetischer Energie, um eine industrielle Anwendung zu ermöglichen. Ebenfalls wurde daran in Dänemark und Deutschland emsig weiter geforscht. Laut Hartmann setzte sich im Deutschen die Bezeichnung „erneuerbare Energien“ im heutigen Sinne erst Anfang der 1970er Jahre durch, obwohl es, so der Sprachwissenschaftler, „physikalisch nicht geht“. Eben um diese Zeit rückte die großtechnische Nutzung der Windkraft in Reichweite. Es entsprach dem Geschäftsinteresse der aufstrebenden Windindustrie, mit der Behauptung der immerwährenden Erneuerung von entzogener Windenergie in beliebigem Umfang die angebliche Unschädlichkeit des anvisierten großräumigen Windkraftausbaus als Tatsache zu verkaufen.
Damit war das Interesse der Politik geweckt, da unter Wissenschaftlern die Sorge vor einem Treibhauseffekt durch CO₂- und andere Treibhausgasemissionen stieg. Die Rede vom „sauberen, grünen“ Windstrom, der aus den regionalen Windsystemen generiert werden könne, wo immer günstige Windstärken hohe Gewinne für Investoren versprechen. Das kam den Politikern überaus gelegen. Den verdächtigen Begriff „Perpetuum mobile“ vermieden die Sinnstifter des Begriffs „erneuerbare Energien“ wohlweislich. Das gilt bis heute. Niemand wagt es, für sich zu reklamieren, die uralte Idee, Energie schadlos aus dem Nichts zu erzeugen, verwirklicht zu haben.
Zu Unrecht wird auch die Photovoltaik als erneuerbare Energie bezeichnet. Wo Sonnenlicht entzogen wird, fehlt es an anderer Stelle, mit weitreichenden Folgen. Besonders große PV-Anlagen wirken aufgrund der Abstrahlung von 85 Prozent des absorbierten Sonnenlichts als riesige Heizkörper in der Atmosphäre, während der Boden darunter austrocknet und abstirbt.
Wenn Expertenrat gefragt ist, wenden sich die Journalisten des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks zumeist an Institutswissenschaftler. Am 11. April 2019 beantwortete der Meteorologe Mojib Latif vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung in der Rundfunksendung „Redezeit“ auf NDR-Info zum Thema „Dürre“ die Frage einer Anruferin, ob die anhaltende Dürre in Deutschland durch immer mehr Windparks verstärkt oder gar hervorgerufen worden sein könnte: „Die meteorologischen Auswirkungen von Windparks sind nicht zu unterschätzen. Aber sie sind nur lokal wirksam und daher hinzunehmen.“ Diese bemerkenswerte Äußerung ging in der Sendung unter. Hierzulande gilt sowieso: Ursache für den überproportionalen Temperaturanstieg in Deutschland, für statische Hochdruckgebiete und rückläufige Niederschläge ist stets und ausschließlich „der Klimawandel“. Daher erfährt die breite Öffentlichkeit nichts von den alarmierenden Ergebnissen Dutzender hochkarätiger internationaler Studien.
Einige Studien untersuchten das Phänomen „Stilling“, die weltweite, hauptsächlich in den mittleren nördlichen Breiten zu beobachtende Abnahme der Windgeschwindigkeiten. „Zugleich mit der Abnahme der Oberflächen-Windgeschwindigkeiten hat das Windkraftpotential während der letzten Jahrzehnte in den meisten Regionen der nördlichen Hemisphäre abgenommen“, liest man in einem Artikel über die vom Institute of Atmospheric Physics der Universität Peking veröffentlichte Studie „Observed and global climate model based changes in wind power potential over the Northern Hemisphere during 1979–2016“ (Januar 2019, ScienceDirect). Dementsprechend impliziert eine überregionale Abnahme der Windgeschwindigkeiten auch überregionale meteorologische Auswirkungen der Windkraft-Nutzung auf die Wetterverhältnisse.
Eine am 10. November vergangenen Jahres veröffentlichte Studie des europäischen Forschungsprogramms European Horizon 2020 mit dem Titel „Long term satellite data show wind farms can affect local air currents“ (Langzeitdaten von Satelliten zeigen, dass Windparks lokale Luftströmungen beeinflussen können) liefert erstmals genauere Daten zum Ausmaß der Windschwächung über Offshore-Windparks in der Nordsee. Gemessen wurde sowohl zehn Meter über als auch innerhalb und zwischen den Windparks. Grundlage der Studie war die Auswertung von Satellitendaten der europäischen Weltraumorganisation ESA aus den vergangenen Jahrzehnten.
Durch die Studie kam heraus, dass über den turbulenten Nachläufen der Windparks (engl. „wakes“) in zehn Metern Höhe eine zwei- bis zehnprozentige Abnahme der Windgeschwindigkeit besteht. Im Mittel haben die Nachläufe eine Länge von 20 bis 40 Kilometern, maximal 100 Kilometern. Nahe der Rotor-Höhe zwischen 80 und 100 Metern über dem Meer werden Windverluste von mehr als zehn Prozent vermutet. Der Erdwissenschaftler Lee Miller vom Pacific Northwest National Laboratory (USA) hat in seiner Abhandlung „The warmth of wind power“ darauf hingewiesen, dass Windkraftanlagen in eine Luftsäule von einem bis drei Kilometern Höhe eingebunden sind, in der etwa die Hälfte der turbulenten atmosphärischen Dissipation (Umwandlung von kinetischer in thermische Energie) stattfindet („Physics today“, 5/2020). Die EU und die Bundesregierung müssen endlich darauf reagieren und ein Windkraft-Moratorium beschließen. Fakt ist, dass andauernde Dürren und sogenannte Winddürren mit einem starken regionalen Ausbau der Windkraft korrelieren.
„,Erneuerbarkeit‘ ist ein Propaganda-Schlagwort, das keine physikalische Wahrheit beinhaltet“, bestätigt der Energieberater Dipl. Ing. Jürgen Weigl aus Graz, der auf 30 Jahre Berufserfahrung zurückblickt. „Wind ist physikalisch nichts anderes als die natürliche Ausgleichsströmung bei Potentialunterschieden innerhalb einer Gasschicht. Die Entnahme von Windenergie zur Stromerzeugung verändert die natürlichen Ausgleichsströmungen, dies mit elementaren Rückwirkungen auf weitere Klimaprozesse wie Verdunstung, Niederschlag, Temperatur, Bodenfeuchtigkeit.“
Davon ausgegangen erscheint es in höchstem Maße unverantwortlich, in einem ohnehin niederschlagsarmen Gebiet einen Windpark zu bauen, noch dazu von gigantischer Größe. Im Norden von Kenia wurden seit 2018/19 im sogenannten Turkana-Windkorridor am südöstlichen Ufer des Turkana-Sees insgesamt 365 Windräder des dänischen Herstellers Vestas mit einer Gesamtleistung von 310 Megawatt in Betrieb genommen. Die guten Gewinnaussichten durch den „Turkana Korridorwind“ mit durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten von 11,4 Metern pro Sekunde hatten Konsortien europäischer und kanadischer Investoren angelockt. Zu dem bisher größten privaten Investment in Afrika gab die EU ein Darlehen von 180 Millionen Euro. Der Windpark gilt als der größte in Afrika und soll 15 Prozent des Strombedarfs von Kenia decken.
In den Trockensavannen im Norden und Nordosten des Landes gestatten die geringen Niederschläge, weniger als 500 Millimeter pro Quadratmeter jährlich, seit jeher keinen Feldbau. Seit Inbetriebnahme des Turkana-Windparks hat es in großen Regionen im Norden Kenias nicht mehr geregnet. Die Herdentiere der nomadisch lebenden Hirtenbevölkerung sind qualvoll verendet. Die Dürre hat den Menschen ihre Lebensgrundlage genommen. Es wird befürchtet, dass die Regenzeit 2023 im fünften Jahr in Folge ausbleiben wird. Die Katastrophe könnte sich sogar noch ausweiten: Bis 2030 will Kenia die Leistung der Windenergie auf 2000 Megawatt erhöhen.

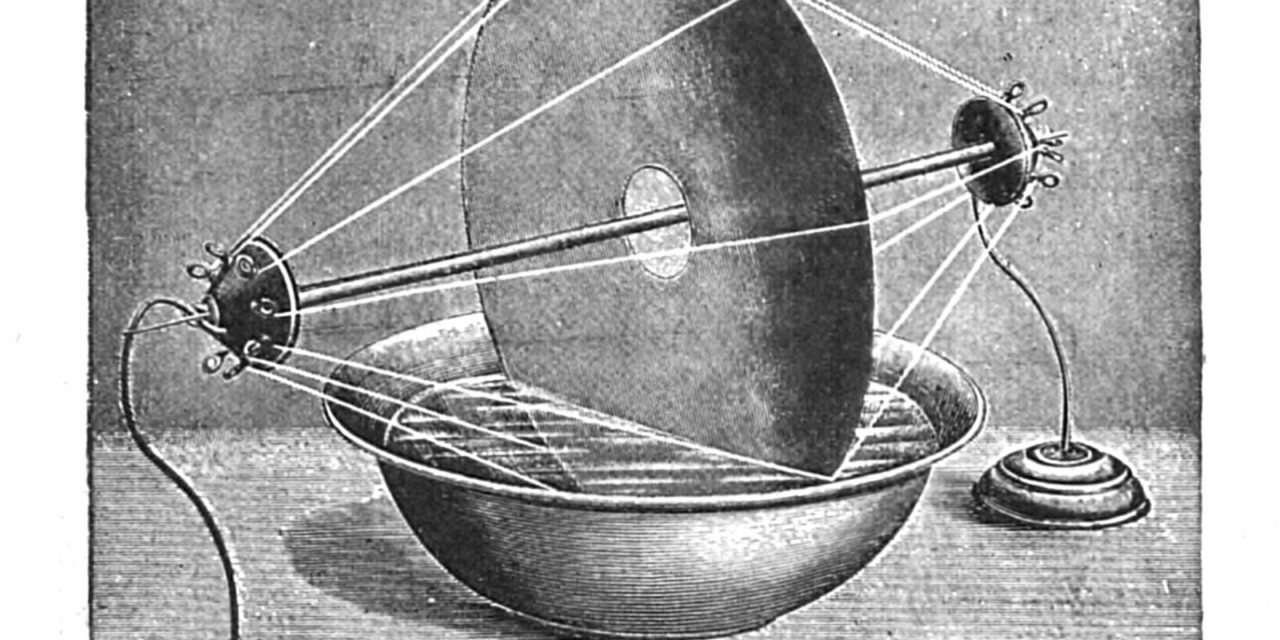



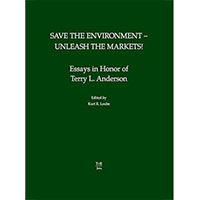

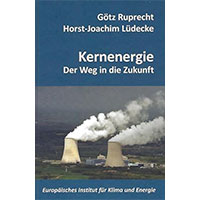
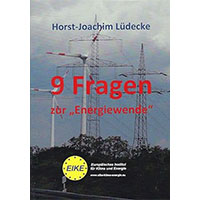


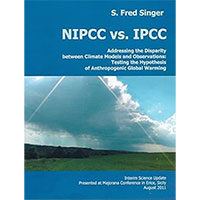



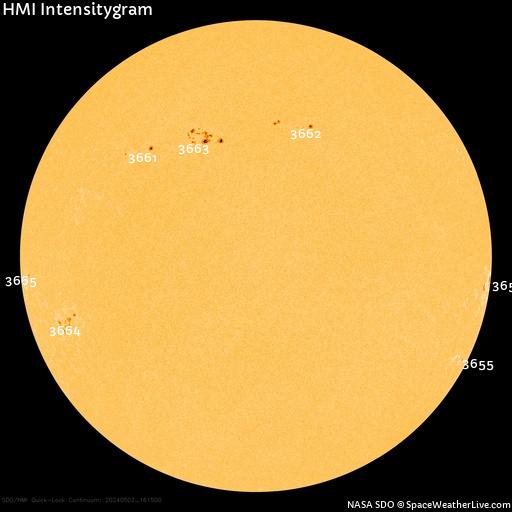
Wie wäre das? Passr doch!
Das Maximum der weltweiten Uranproduktion war 2016. Wer Uran kaufen will, muss sich an Kasachstan (russischer Einflussbereich) wenden. Von der BGR wurden 2008 weltweite Uranreserven geschätzt. Von diesen Reserven ist seitdem die Hälfte gefördert.
Das Maximum der weltweiten Gasproduktion wird auf 2024 geschätzt.
Sämtliche wirtschaftlich erreichbare Steinkohle in Deutschland ist gefördert. Der Steinkohlepreis hat sich seit 2020 verdreifacht.
In Deutschland gibt es an fossilen Brennstoffen nur noch Reste von Braunkohle und eventuell etwas Frackinggas. In ganz Europa sieht es ähnlich aus.
Es ist höchste Zeit, sich von den fossilen Brennstoffen unabhängig zu machen.
Alle fossilen Energieträger werden mehr gefördert als vorher und ein Ende dieser Quellen ist absolut nicht abzusehen. Keine einzige Kurve geht runter sondern es wird immer mehr gefördert schon seit 1900.
Dass uns irgendeine Energiequelle ausgeht ist wieder mal eine Fiktion und hat wenig mit Fakten zu tun.
Das Maximum der weltweiten Erdölproduktion war im November 2018.
Das Maximum der Gas- und Erdölgewinnung hatten wir in Deutschland bereits vor Jahrzehnten.
Deutsche fossile Energieträger trage fast nichts zur Energieversorgung bei, ca. 0,6% bringt deutsches Öl und ca. 1,6% Gas der benötigten Primärenergie.
Recht patriotisch. Oder habe ich ein s vergessen?
Diese Statistik beunruhigt sie?
Wieviel Rohstoffe für Solarpanele kommen aus Deutschland?
Kommen Solarpanele noch aus Deutschland?
Wie werden Windkraftanlage hergestellt?
Verbundstoffe auf Grundlage von Maisstaerke?
Der Mais kommt woher?
Und im Getriebe mit Rapsöl.
Bitte, wenn dann eine Gesamtaufstellung. Vielleicht lernen sie noch was ohne sich nationalistisch zu radikalisieren.
Förderkosten sind eine von Zentralbanken leicht manipulierbare Größe, das ist schon mal falsch. Da sich die Reserven alle auf Energierohstoffe beziehen, ist „Förderkosten“ also durch „Energieaufwand“ zu ersetzen.
Fördertechnik hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht geändert. Fracking in den USA wurde ermöglicht durch Wegfall von Auflagen, nicht durch neue Technik. Das ist also auch falsch.
Richtig ist: Die Größe der Förderbaren Reserven ist bestimmt durch Energieaufwand und Umweltauflagen.
Ihre Antwort ist also völlig falsch.
Ihre Antwort ist also völlig falsch.“
Wenn ich das lese frage ich mich ob der IQ in Blödland in den letzten Jahren nicht nur um 3%, sondern um 30% gefallen ist.
Her Henrich hat völlig Recht!
Preis = Summe aller Kosten, die für die Bereitstellung einer Dienstleistung oder Ware aufgewendet wurden, und des vom Anbieter / Produzenten erhofften Gewinns.
Im Preis enthalten sind Lohnkosten + Anschaffungs-, Wartungs-, Betriebskosten der Werkzeuge / Maschinen + Energiekosten + Kosten der staatlichen Auflagen + Abgaben + Steuern.
Energiekosten hängen natürlich auch ab von der Höhe des Energieaufwandes.
Anbieter / Produzenten arbeiten nur wirtschaftlich, wenn es genug Nachfrage von Kunden gibt, die diese von den Anbietern / Produzenten für die Dienstleistungen / Waren festgesetzten Preise bezahlen wollen.
Eine Wirtschaftlichkeitsrechnung sollte es auch für die Erschließung, Förderung und Bereitstellung von Rohstoffen geben.
Als Störfaktor bei der Preisgestaltung fungiert der Staat mit Auflagen, Abgaben und Steuern, aber auch mit Subventionen, mit denen er die Preise beeinflusst.
„Förderkosten sind eine von Zentralbanken leicht manipulierbare Größe“?
Besser kann man den Einfluss der Zentralbanken auf Kosten nicht beschreiben. Kosten sind eine manipulierbare Größe. Geld ist kein fester Wert, sondern etwas sich permanent Änderndes. Schon mal von Inflation gehört ?
Im Gegensatz dazu gilt für eine Ölquelle, das der Aufwand zur Ölförderung bestimmt ist durch die Energie, die man zur Förderung einsetzen muss. Wenn man mit einem Liter Öl 10 Liter aus der Erde holen kann, ist die Welt in Ordnung. Wenn man pro Liter Öl einen Liter Öl zur Förderung einsetzen muss, wird man die Ölquelle dicht machen, Dann ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Beides ist völlig unabhängig davon, was der Liter Öl in Euro kostet.
Dabei beschränkt sich der Aufwand nicht nur auf den reinen Pumpvorgang, sondern man muss auch den Aufwand für Raffinerien, Strassen, Ausbildung, Fahrzeuge, Militär usw. mit einbeziehen.
Die Definition passt vielleicht nicht in ihr kleines Weltbild, aber es ist eine Definition von Rohstoff-Reserve.
Bildung schützt vor Selbst-Indoktrination.
Bitte belesen sie sich.
Dimension: Preis / Größe: Geld / Einheit: Euro, Dollar usw.
Was ist Geld?
Ein Obstbauer möchte von einem Bäcker Brötchen haben, weshalb er dem Bäcker im Tausch für die Brötchen seine Äpfel anbietet. Der Bäcker ist allerdings nicht an Äpfel, sondern an Milch interessiert.
Der Obstbauer geht deshalb zu einem Milchbauer und tauscht 10 Äpfel gegen eine Kanne Milch. Damit geht er wieder zum Bäcker und tauscht die Kanne Milch gegen 5 Brötchen.
Der Preis für die Kanne Milch betrug also 10 Äpfel und der für die 5 Brötchen eine Kanne Milch.
Vom Standpunkt des Obstbauern haben die 5 Brötchen 10 Äpfel gekostet, vom Standpunkt des Milchbauern haben 10 Äpfel eine Kanne Milch gekostet und vom Standpunkt des Bäckers kostete die Kanne Milch 5 Brötchen.
Die Preise werden von den Tauschpartnern vereinbart. Dabei interessiert den Obstbauern nicht, welchen Aufwand der Milchbauer für seine Milch und der Bäcker für seine Brötchen treiben musste. Umgekehrt gilt das auch für den Milchbauer und Bäcker, denen es egal sein kann, welchen Aufwand der Obstbauer für seine Äpfel getrieben hat.
Mit der Erfindung des Geldes lässt sich der Tauschhandel vereinfachen: Obstbauer geht zum Bäcker und tauscht Geld gegen Brötchen, der Bäcker geht zum Milchbauer und tauscht Geld gegen Milch und der Milchbauer tauscht beim Obstbauer Geld gegen Äpfel. Man kann also direkt und ohne Umstände das Erwünschte gegen Geld tauschen.
Geld ist das universellste Tauschmittel, abzählbar, gut zu transportieren und sollte auch nicht beliebig vermehrbar sein.
Mit dem Geld hat man jetzt die Möglichkeit, dem Preis eine Einheitsgröße zu zuordnen: Preis = Geld(betrag) = Zahlenwert x Geldeinheit (Euro, DM, Dollar, Yen, Rubel, …).
Beispiel: Steinkohlekraftwerk
Wenn der Preis für australische Steinkohle, inklusive Transportkosten, geringer ist als der für die heimische Steinkohle, wird der Betreiber des Steinkohlekraftwerks die australische Steinkohle kaufen. Dem Steinkohlekraftwerksbetreiber kann es egal sein, warum die Steinkohle aus Australien billiger als die heimische Steinkohle ist.
Beispiel: Erdölförderung
Wenn man mit 1x Kosten (Geldbetrag) y Liter Erdöl fördert und für die y Liter Erdöl Käufer hat, die mit dem Geldbetrag 10x bezahlen, wird ein Gewinn von 10x minus 1x = 9x gemacht.
Wenn man mit 10x Kosten y Liter Erdöl fördert und für die y Liter Erdöl Käufer hat, die
mit dem Geldbetrag 11x bezahlen, wird ein Gewinn von 11x minus 10x = 1x gemacht.
Wenn man mit 10x Kosten y Liter Erdöl fördert und für die y Liter Erdöl Käufer hat, die
mit dem Geldbetrag 9x bezahlen, wird ein Verlust von 9x minus 10x = -1x gemacht und die Erdölförderung lohnt nicht mehr.
Ob man Erdöl fördert oder nicht, hängt nur davon ab, ob man Käufer findet, denen man das Erdöl mit Gewinn verkaufen kann.
Wenn ein Liter Erdöl verbraucht wird, um einen Liter Erdöl zu fördern, bricht die Erdölförderung zusammen.
Etwas komplizierter und genauer: Wenn der Energieinhalt eines Liters Erdöl verbraucht wird, um einen Liter Erdöl zu fördern, ist das kritisch für die Erdölförderung. Es kann aber solange gut gehen, wie die verbrauchte Energie nicht aus Erdöl stammt und selbst mit sehr niedrigem Energieaufwand erzeugt wird.
Compris ?
Wenn ich dasselbe mit Geld erkläre, kommt dasselbe raus. Aber es gibt einen kleinen Unterschied: Wenn dem Erdölförderer ein Kredit gegeben wird, kann er fördern, selbst wenn es nicht kostendeckend ist. Dann gibt es kein energetisches Problem, höchstens Inflation.
Damit erkennen sie auch, was Geld ist: Ein Kredit bzw. das Versprechen, Schulden zurück zu zahlen.
Sie haben ja völlig recht, aber der Herr Cohnen hat eine „rotzgrüne Sozialisierung“ abbekommen, deshalb wird er geistig nicht in der Lage sein Ihren völlig richtigen Gedankengängen zu folgen …….
„Wenn ein Liter Erdöl verbraucht wird, um einen Liter Erdöl zu fördern, bricht die Erdölförderung zusammen.“
Unter Kredit versteht man allgemein die Übereignung von Bargeld (Banknoten, Münzen), Buchgeld oder vertretbaren Sachen vom Kreditgeber zwecks befristeter Gebrauchsüberlassung durch den Kreditnehmer, der sich zu einer zukünftigen Tilgung und häufig auch zu einer Gegenleistung in Form von Kreditzinsen verpflichtet.
Ein Kreditgeber, der nur über begrenzte Mittel verfügt, von denen er zeitlich befristet bereit ist, einen Teil zu verleihen, ist daran interessiert, dass der Kreditnehmer den Kredit zurückzahlen kann.
Wenn man mit x Einheiten von irgendetwas, das man mit y Einheiten eigenem oder geliehenem Geld bezahlt, ein Liter Erdöl fördert, wofür man von Kunden mehr als y Einheiten Geld pro Liter Erdöl bekommt, lohnt sich die Erdölförderung und der Erdölförderer wirtschaftet wirtschaftlich (gewinnbringend).
Mit einer Wirtschaftsrechnung ermittelt man die Wirtschaftlichkeit von auf Geldtransfers beruhenden Handlungen durch den Vergleich von Einnahmen und Ausgaben.
Die auf Geldrechnung beruhende Wirtschaftsrechnung vergleicht den Tauschwert in Geldeinheiten von Waren und Dienstleistungen.
Der Tauschwert wiederum ist abhängig von Angebot und Nachfrage.
In einer arbeitsteiligen Gesellschaft mit der verwirrenden Fülle von verwendeten Rohstoffen, Zwischenprodukten, Fertigprodukten und Arbeitsleistungen ist nur mit einer auf Geldrechnung basierenden Wirtschaftsrechnung rationales Wirtschaften möglich.
Rationales Wirtschaften heißt, mit einem Minimum an Ressourcen maximale Ergebnisse erzielen, Gewinne erwirtschaften oder Verluste vermeiden.
Ist in einer arbeitsteiligen Gesellschaft die Geldmenge begrenzt, dann ist auch die Kreditmenge begrenzt.
Man unterscheidet beim Kredit zwischen Konsumkredit, Investitionskredit und Spekulationskredit.
Wird ein Investitionskredit für ein unwirtschaftliches Projekt verwendet, dann kann er und der eventuell vereinbarte Zins zumindest nicht vollständig dem Kreditgeber zurückgezahlt werden. Die Folge ist keine Inflation, sondern durch eine nicht gewinnbringende Investition verpasste Chance, die Gesellschaft zu bereichern, oder verursachte Verarmung der Gesellschaft.
Weiter diskutieren hat dann noch nie Sinn gemacht.
Wenn Ihren Beitrag so lese, liegt das Problem wohl mehr bei Ihnen …..
Dann würde abstellbare Energien besser passen. Wenn die Dinger kaputt gehen, ist es die beste Gelegenheit sie für immer abzuschaffen. Das sollte nichts erneuert sondern lieber komplett abgeschafft werden.
Kann mir jemand erklären, was dieser Heizkörper denn heizt? Bisher war ich der Meinung, dass die Luft von dem durch die Sonnenstrhlung erwärmten Boden erwärmt würde. Wenn nun 85% dieser Sonnenstrahlung in Richtung Weltraum abgestrahlt werden, sollte daraus eine Abkühlung resultieren.
Endlich ist der Beweis erbracht, dass die Grünen Recht haben und PV-Anlagen die „Erderhitzung“ verhindern. 😛
…während der Boden darunter austrocknet und abstirbt… Das ist natürlich richtig.
Damit gibt es auch keine Probleme mit diesen Begriffen.
Silke Kosch
Lügen der Lügenpresse ≠ „Alle wissen“
Ich weiß davon nichts. Für mich gibt es keine erneuerbare Energien.
Die menschliche Sprache bildet nie die Realität eins zu eins ab, sondern menschliche Sprache bildet immer nur die Vorstellung des Menschen von der Realität ab und eine Bezeichnung für etwas zu finden.
Beispiele:
Panzerfaust, ist das eine Faust?
Zitronenfalte, faltet da jemand Zitronen?
Bienenstich, gestochen oder was gegessen?
Wermutstropfen, tropft da was?
Kernkraftwerk oder Kernspaltungskraftwerk?
Stromverbrauch, elektrischen Ladungsträger verbraucht?
Mund-zu-Mund-Propaganda oder doch Mund-zu-Ohr-Propaganda?
Tankwart, macht der eine Wartung?
Atomausstieg, steigen da Atome aus?
u.s.w.
Aber hier kommt ein Mechanismus rein, nämlich die menschliche Faulheit, immer möglichst wenig sprechen und schreiben zu müssen.
Also wenn es um erneuerbare Energien geht, sprechen wir am Ende in der Regle von Sonnenenergie in den verschiedensten Formen.
Der physikalische Begriff „erneuerbar“ und der Begriff erneuerbare Energien unterscheiden sich.
Erneuerbare Energien stammt nicht das der physikalischen Betrachtung, sondern aus dem eingebürgerten Sprachgebrauch.
99% aller Mensch wissen, was der Begriff erneuerbare Energien bedeutet und immer noch 1% denkt bei den erneuerbaren Energien, dass man da Energie erneuern kann, gut die denken auch, dass der Zitronenfalter Zitronen faltet.
Ach, die Frau Fröhlich wirft mal wieder mit Nebelkerzen….
Möglicherweise geht das ja nicht in ein grünes Gehirn: ES GIBT KEINE ERNEUERBARE ENERGIE!!!!
Nicht mal die Sonne kann Energie „erneuern“. Aber wenn mal MINT-Fächer nie verstanden hat, kann man natürlich nicht wissen, dass für eine richtige fachliche Unterhaltung die fachlich richtige Terminologie Grundbedingung ist. Grünes „Hausfrauendeutsch“ reicht da leider nicht …..
Ute Fröhlich, ist das eine Frau und immer fröhlich?
Auch hier spielt die Deutsche Sprache uns einen Streich, es ist nicht die hübsche, fröhliche, Prinzessin am Brunnenrand sonder der quakende Frosch im Brunnen der auch durch noch soviel Küsse nicht zum Prinzen wird, er bleibt ein dummer grüner Frosch, für immer im Sumpf der eigenen Dummheit gefangen .
Gut dass wir das geklärt haben.
Vielleicht sollte Ute Fröhlich das von ihr hier Geschriebene einmal zu einer Dissertation ausbauen und zum Beispiel in Potsdam beim PIK einreichen. Die Welt hat genung Scharlatane, dass wir dann auf eine „Dr. Ute Fröhlich in spe“ hoffen können, dann wären ihre Weltverdummungsansätze wenigstens geadelt.
Das selbe Prinzip herrscht bei jeder Energie, auch das Gas, welches morgen verbraucht wird, ist ein anderes als jenes von heute.
Der wesentliche Unterschied ist, der Strom der Sonnenenergie wird auf absehbare Zeit ununterbrochen und ohne Angst vor einem Versiegen weiterfließen. Bei Gas sieht das anders aus.
Angeblich ist es für die Erde ohne Unterschied, ob man aus Wind und PV Strom erzeugt oder nicht. Das behaupten zumindest die Befürworter dieser Methoden. Ist irgendwie schwer vorstellbar.
Es wird in Kürze, in neuer Übersetzung neu aufgelegt, hier erhältlich sein.
Mit Sicherheit.
https://www.youtube.com/watch?v=Gvw-r-52FTQ.