Applikationen der Künstlichen Intelligenz (KI) benötigen enorme Mengen an Energie. Es entstehen darum immer neue Rechenzentren, die laufend mehr Strom brauchen. Das dürfte die Versorgung in Deutschland bald vor zusätzliche Probleme stellen.
Von Peter Panther
Im Jahr 2022 verbrauchten Rechenzentren in Deutschland 18 Terawattstunden Strom. Das ist die Hälfte mehr, als ganz Berlin benötigt. Der Verbrauch der Rechenzentren lag um 70 Prozent höher als noch 2010.
Und er dürfte noch weit mehr zunehmen. Laut dem Borderstep Institut könnte der Stromverbrauch der Rechenzentren bis 2030 auf jährlich 30 Terawattstunden steigen. Das wären dann satte sechs Prozent der Stromnachfrage in ganz Deutschland.
Der Energiehunger von Rechenzentren ist enorm. Das liegt in erster Linie an der Künstlichen Intelligenz. Ihre Applikationen verschlingen grosse Mengen an Strom, weil sie die benötigten Daten auf unzähligen Servern der Welt zusammensuchen. So braucht eine Google-Suche, die auf KI beruht, rund zehnmal so viel Strom wie eine herkömmliche Google-Suche.
Weltweit verschlangen Rechenzentren im Jahr 2022 schon zwei Prozent des produzierten Stroms. Und es wird laufend mehr: Gemäss den Angaben der Amazon Web Services geht derzeit alle drei Tage ein neues Rechenzentrum irgendwo auf der Welt in Betrieb. Die Internationale Energie-Agentur schätzte vor zwei Jahren, dass die Stromnachfrage von Rechenzentren bis 2026 um 80 Prozent zunimmt. Das wäre ein Plus, das dem gesamten aktuellen Stromverbrauch Deutschlands entspricht.
«Wir brauchen die Kernfusion»
Entsprechend alarmiert sind Fachleute. «Diese KI-Rechenzentren werden mehr Energie benötigen, als wir uns je hätten vorstellen können», warnte Blackrock-Chef Larry Fink im letzten Mai. Sam Altman, Chef der KI-Firma Open AI, schlug in die gleiche Kerbe: «Ich glaube, wir wissen immer noch nicht, wie hoch der Energiebedarf dieser Technologie ist», meinte er kürzlich. Dieser Bedarf könne «nicht ohne einen Durchbruch» gedeckt werden. «Wir brauchen die Kernfusion oder radikal billigere Solarenergie plus Speicherung, und zwar in einem Ausmass, das niemand wirklich plant.»
Der renommierte Wirtschaftshistoriker Daniel Yergin sagte vor kurzem zum «Handelsblatt»: «Das Wachstum Künstlicher Intelligenz wird die Energiesysteme weltweit auf die Probe stellen.» Da und dort ist es bereits so weit: In den USA, wo mehr als ein Drittel aller Rechenzentren weltweit stehen, sind Versorgungsengpässe an der Tagesordnung. Sie führen dazu, dass sich die Inbetriebnahme neuer Datencenter zum Teil um Jahre verzögert.
Auch in Irland ist die Stromversorgung gefährdet: 2022 prognostizierten Hochrechnungen, dass der Energiebedarf der Rechenzentren von aktuell 11 auf sagenhafte 40 Prozent steigen könnte. Der staatliche Übertragungsnetzbetreiber EirGrid zog daraufhin die Notbremse und stoppte 30 Projekte. Genehmigungen für neue Rechenzentren gab es daraufhin keine mehr.
Moratorium in den Niederlanden für Rechenzentren
Ebenfalls 2022 gerieten die Niederlande in Stromnöte. Die Regierung verhängte darum ein Moratorium für die Genehmigung neuer grosser Rechenzentren, das immerhin neun Monate dauerte. Es war die Rede von einem «unverhältnismässig hohen» Energieverbrauch der Rechenzentren. Insbesondere gab es Widerstand gegen ein geplantes Rechenzentrum des Tech-Giganten Meta, das alleine fast 1,4 Gigawatt Strom benötigt hätte – soviel, wie ein grosses Kernkraftwerk liefert. Der niederländische Senat hiess einen Vorstoss gut, der die Regierung aufforderte, den Bau zu stoppen. Meta legte seine Pläne daraufhin auf Eis.
Die öffentliche Stromversorgung kommt an vielen Orten der Welt zusätzlich unter Druck, weil die Betreiber von Rechenzentren feste Lieferverträge mit den Energieproduzenten abschliessen. Die Abnehmer verpflichten sich dabei, eine bestimmte Strommenge zu einem festgelegten Preis zu kaufen. Solche Verträge, auch «Power Purchase Agreements» (PPA) genannt, laufen in der Regel über zehn bis zwanzig Jahre. Sie führen dazu, dass jeweils ein erheblicher Anteil der Stromproduktion nicht mehr dem öffentlichen Netz zur Verfügung steht.
Microsoft hat sich Strom vom deutschen Solarfeld Witznitz gesichert
So kündigte der Technologie-Konzern Microsoft im letzten Mai Investitionen von zehn Milliarden Dollar an, um sich in den USA über zehn Gigawatt Strom aus grünen Energiequellen für die eigenen Datenzentren zu sichern. Das Tech-Unternehmen Amazon gab derweil ein langfristiges PPA mit dem US-amerikanischen Energieversorger AES Corp. bekannt. Der verkaufte Strom kommt dabei aus einem riesigen Solarfeld.
Auch in Deutschland haben PPAs Einzug gehalten: Microsoft sicherte sich mit einer entsprechenden Vereinbarung mit Shell über 300 Megawatt Leistung aus dem grössten deutschen Solarpark Witznitz. Überhaupt sind die Betreiber von Rechenzentren erpicht darauf, sich wenn immer möglich sogenannt nachhaltigen Strom zu ergattern. Es macht sich eben aus Imagegründen besonders gut, als ökologischer Vorreiter dazustehen. Angeblich bezieht die Branche der Rechenzentren in den USA schon heute zwei Drittel ihrer Energie aus nachhaltigen Quellen.
Der Energiehunger der KI-Branche stellt die deutsche Elektrizitätsbranche jedenfalls vor zusätzliche Probleme. Der Stromverbrauch wird in den nächsten Jahren bereits wegen der Elektrifizierung des Verkehrs und des Gebäudebereichs steil ansteigen. Der Bedarf der Rechenzentren kommt da noch oben drauf. Zudem soll die Stromversorgung in Deutschland bis 2050 ganz auf Wind und Sonne beruhen. Für 2030 ist immerhin ein 80-Prozent-Ziel für erneuerbaren Strom gesetzt.
Deutschland droht den Anschluss zu verlieren
Doch wegen der Energiewende sind die Strompreise in Deutschland hoch. Es mehren sich zudem die Zweifel, dass die Versorgung auch künftig gesichert ist. Schon heute seien diese Umstände mit Blick auf die Ansiedelung von Rechenzentren ein Nachteil, sagte Kilian Wagner vom Digitalverband Bitkom kürzlich in einem Interview. Letztes Jahr zum Beispiel seien den Rechenzentren wegen steigender Strompreise rund 1,8 Milliarden Euro Mehrkosten entstanden. «Wenn die Politik nicht mit Strompreisentlastungen für Rechenzentren gegensteuern, verlieren wir den Anschluss.» Bereits jetzt gebe es in Deutschland, verglichen mit der Wirtschaftsleistung, zu wenige Datencenter.
Der Boom der KI-Branche dürfte jedenfalls dazu beitragen, dass die Energiewende weltweit ins Stocken gerät. Der erwähnte Wirtschaftsspezialist Daniel Yergin rechnet gemäss «Handelsblatt» damit, dass vor allem Erdgas noch länger eine wichtige Rolle spielen wird – weil Wind- und Solarenergie den entsprechenden Stromhunger nicht stillen könnten. Ein Ende der fossilen Brennstoff bis 2050 sei darum eine Illusion.

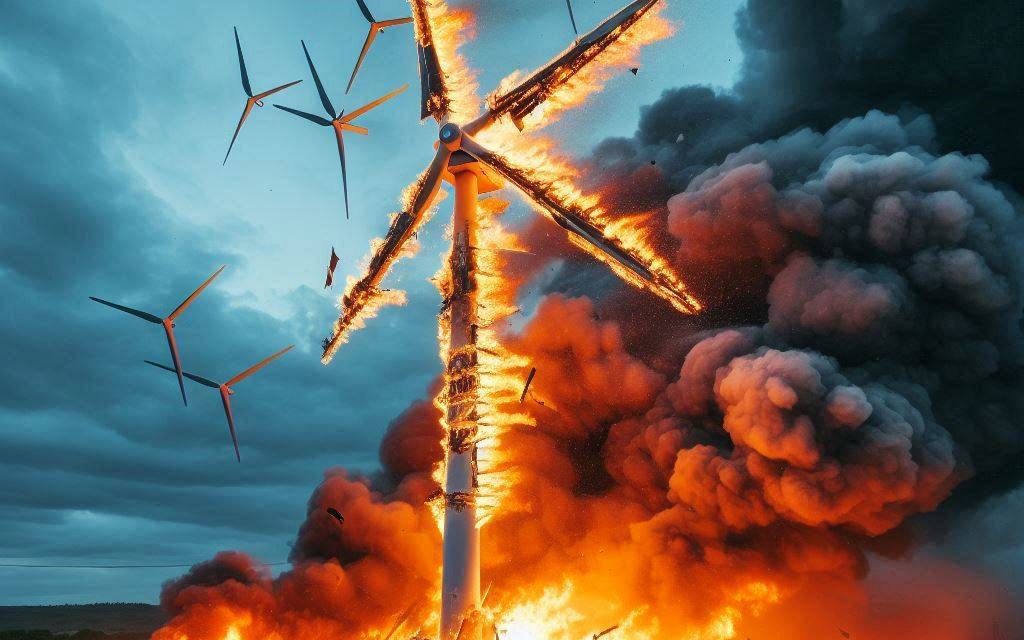


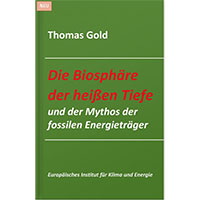
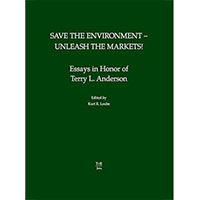
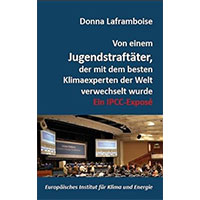
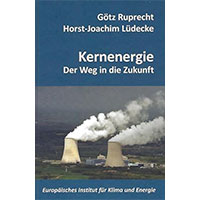
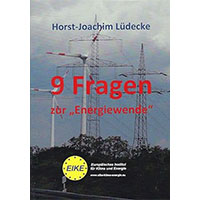
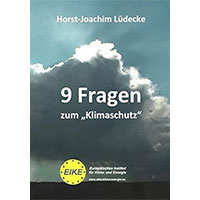
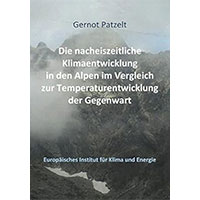
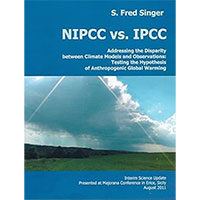
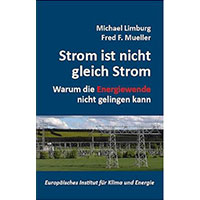
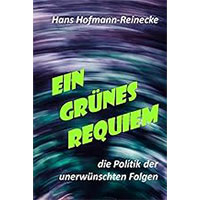


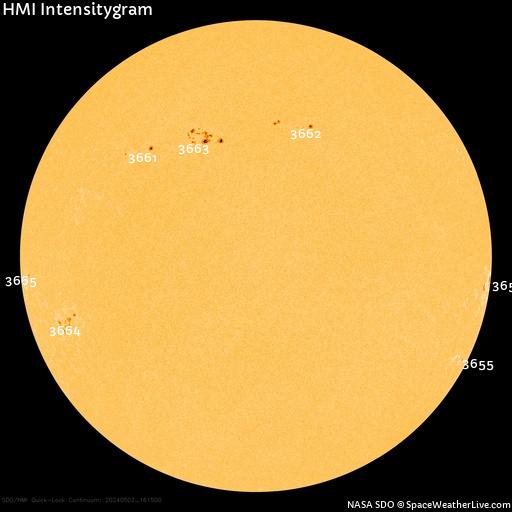
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
- Bitte geben Sie Ihren Namen an (Benutzerprofil) - Kommentare "von anonym" werden gelöscht.
- Vermeiden Sie Allgemeinplätze, Beleidigungen oder Fäkal- Sprache, es sei denn, dass sie in einem notwendigen Zitat enthalten oder für die Anmerkung wichtig sind. Vermeiden Sie Schmähreden, andauernde Wiederholungen und jede Form von Mißachtung von Gegnern. Auch lange Präsentationen von Amateur-Theorien bitten wir zu vermeiden.
- Bleiben Sie beim Thema des zu kommentierenden Beitrags. Gehen Sie in Diskussionen mit Bloggern anderer Meinung auf deren Argumente ein und weichen Sie nicht durch Eröffnen laufend neuer Themen aus. Beschränken Sie sich auf eine zumutbare Anzahl von Kommentaren pro Zeit. Versuchte Majorisierung unseres Kommentarblogs, wie z.B. durch extrem häufiges Posten, permanente Wiederholungen etc. (Forentrolle) wird von uns mit Sperren beantwortet.
- Sie können anderer Meinung sein, aber vermeiden Sie persönliche Angriffe.
- Drohungen werden ernst genommen und ggf. an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben.
- Spam und Werbung sind im Kommentarbereich nicht erlaubt.
Diese Richtlinien sind sehr allgemein und können nicht jede mögliche Situation abdecken. Nehmen Sie deshalb bitte nicht an, dass das EIKE Management mit Ihnen übereinstimmt oder sonst Ihre Anmerkungen gutheißt. Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, Anmerkungen zu filtern oder zu löschen oder zu bestreiten und dies ganz allein nach unserem Gutdünken. Wenn Sie finden, dass Ihre Anmerkung unpassend gefiltert wurde, schicken Sie uns bitte eine Mail über "Über Uns->Kontakt"Wenn es mit der Natürlichen Intelligenz nicht so recht klappt, soll es wohl die Künstliche Intelligenz richten? Als ob die Künstliche Intelligenz etwas anderes als ein „billiger“ Abklatsch der Natürlichen Intelligenz wäre. Taugt das Eine nichts, richtet es auch das Andere nicht. Aber sach das mal einem „Gutmenschen“.
Der nächste Betrug! Dieser „Strombezug“ ist nur eine Bilanzgrösse da ein Rechenzentrum natürlich 24/24 h an 7/7 d läuft und somit nicht mit Flatterstrom aus Wind und Sonne betrieben wird. Es werden neue regelbare Kraftwerke gebraucht – und auch gebaut….
„Überhaupt sind die Betreiber von Rechenzentren erpicht darauf, sich wenn immer möglich sogenannt nachhaltigen Strom zu ergattern.“
Erstaunlich, Künstliche Intelligenz gibt es also nur, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint. Auf natürliche Intelligenz braucht man nicht zu hoffen, die ist futsch. Vor allem nachts wird es schwierig. Wärmepumpen haben Vorrang, doch Strom gibt es im Winter keinen – nur für KI. Dort gibt es riesige Datenspeicher. Speicher lässt Grüne vor Freude hüpfen, die grüne Lösung, genauso wie die Tiefkühlhähnchen. Flatterstrom, der dank Lücken und Netzausbau auch noch sauteuer ist. Für ein Land, das von grüner „Intelligenz“ gegen die Wand gesteuert wird, reicht es.
Das heisst, dass Rechenzentrten nach Sonneuntergang schalten ab?!
Zuerst müsste mal geklärt werden, wieviel TWh in Bitcoins, Börsenspekulation und Nonsens-Anfragen investiert werden. Ansonsten wäre ich dafür, bei Stromknappheit nachts alle Router abzuschalten. Es gab ein Leben vor dem Internet, auch an Forschungsinstituten.
„verlieren wir den Anschluss.“
WELCHEN „Anschluss“??? Den hatten wir digital noch nie! Albanien hat uns im digital Funk lächerlich gemacht & den derzeitigen „Anschluss“, können wir mit dem der 3. Welt vergleichen…
Die Kernenergie wird es in Zukunft richten. Nicht der Quatsch aus Windrädeln und „Solarparks“. Diese Begriffe sind schon toll. Was heutzutage alles ein Park sein kann.
Im letzten Jahr hat Deutschland knapp 12 TWh Strom importiert, 2024 schon jetzt fast 10 TWh importiert. Vor allem Atomstrom aus Frankreich.
https://www.energy-charts.info/charts/import_export/chart.htm?l=de&c=DE&year=2023
Den nehmen wir dann für die KI, die E-Autos und E-Wärmepumpen…
Die Ökos haben es nur noch nicht begriffen das wir jetzt schon Strommangel haben trotz Abwanderung der Industrie!
Auch das noch, es reicht wohl nicht das die Energiesicherheit von natürlich-grüner „Intelligenz“ gefährdet wurde/wird?
:-O
„Wir brauchen die Fusion“. Auch so ein Witz. Wir haben momentan die Spaltung und die neuen Anwendungen sind um Faktoren im 4-stelligen Bereich effizienter als PV. Auf die Fusion können wir und nicht verlassen, die ist noch weit weg. Man kann diesen Dilettanten in unseren Regierungen in Europa nicht mehr zuschauen.
Ist immer nur eine Frage vom Preis bei den fossilen Brennstoffen.
Es wird niemals ein Ende der „fossilen“ Brennstoffe geben.