Über die nukleare Renaissance in Frankreich und Europa
Edgar L. Gärtner
Die französischen Präsidentschaftswahlen im nächsten Frühjahr werden wohl nicht so ablaufen, wie sie der zurzeit bekannteste französische Romanautor Michel Houellebecq vor sieben Jahren in seinem Bestseller „Soumission“ (Unterwerfung) skizziert hat. (Wobei ich der Fairness halber darauf hinweisen muss, dass Houellebecq sich nie als Prophet verstanden hat.) Um den absehbaren Wahlsieg der rechtsnationalen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen zu verhindern, kommen in Houellebecqs Roman die Parteien der Linken und der gemäßigten Rechten überein, anstelle der Kandidatur des zentristischen Amtsinhabers die Kandidatur des hochintelligenten und charismatischen Muslimbruders Mohammed Ben Abbes zu unterstützen, der eine aufgeklärte und gemäßigte Version des Islam vertritt. Wie erwartet siegt Ben Abbes haushoch und setzt unverzüglich sein von der Scharia und der katholischen Soziallehre inspiriertes sozialpolitisches Programm um.
Dieses Szenario erscheint inzwischen als wenig realistisch, denn die Aussichten Marine Le Pens, an die Macht zu gelangen, haben sich inzwischen keineswegs verbessert. Im Gegenteil ist Marine Le Pen inzwischen in Gestalt des algerienstämmigen jüdischen Publizisten Eric Zemmour ein Konkurrent erwachsen, der ihr nicht nur an Intelligenz, sondern vermutlich auch an finanziellem Rückhalt haushoch überlegen ist. Zemmour, der bislang seine Kandidatur noch nicht offiziell angekündigt hat, füllt zurzeit in Frankreich die größten Säle mit Werbe-Auftritten für sein neuestes Buch mit dem Titel „La France n’a pas dit son dernier mot“ („Frankreich hat noch etwas zu sagen“). In den Meinungsumfragen hat er Marine Le Pen bereits überholt. Deshalb sieht es im Moment eher nach einem Duell Macron-Zemmour in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen aus. Aber noch ist Zemmour, wie gesagt, noch gar nicht erklärter Kandidat und es ist auch noch nicht ausgemacht, wie sich die gemäßigten Rechten (Republikaner), die ihren Präsidentschaftskandidaten auch noch nicht bestimmt haben, gegenüber Zemmour positionieren würden.
Bedenklich stimmt vor allem Zemmours einseitige Ausrichtung auf die Probleme der illegalen Masseneinwanderung und die Gefahr des Islamismus, während er andere Bedrohungen der Freiheit wie vor allem die vom Staat erpresserisch durchgesetzte Anti-Covid-Impfpflicht, die bis zur Unbezahlbarkeit gehende Verteuerung des Lebens einfacher Menschen durch die von der EU beschlossene Bepreisung des Lebenselixiers Kohlenstoffdioxid und die Enteignung der Sparer durch die Inflationspolitik der Europäischen Zentralbank offenbar als weniger problematisch ansieht. Gemeinsam ist aber allen potenziell aussichtsreichen Wettbewerbern Macrons die Betonung des nationalen Interesses an einer Reindustrialisierung Frankreichs, am Ausbau der Kernenergie und damit die Distanzierung vom deutschen Weg in die Sackgasse mit 100 Prozent „erneuerbarem“ Flatterstrom.
Das Ende der deutsch-französischen Harmonie
Auch Emmanuel Macron weiß, dass das Streben nach einem gemeinsamen deutsch-französischen Weg, was immer auch darunter zu verstehen sein mag, mit dem Ende der Ära Merkel hinfällig geworden ist. In Frankreich stehen die Zeichen aktuell auf wirtschaftlicher Expansion. Das nationale Statistikamt INSEE erwartet für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 6,6 Prozent. Schon bevor ein Ende der „Pandemie“ in Sicht ist, hat die französische Wirtschaft die durch den „Lockdown“ verursachte Wachstumsdelle wieder wettgemacht. Führende französische Wirtschaftswissenschaftler, darunter Nobelpreisträger Jean Tirole, erwarten ein Jahrzehnt kräftigen Wirtschaftswachstums – ähnlich dem, das den Unruhen vom Mai 1968 folgte. Die französischen Privathaushalte haben, wie es scheint, während der „Pandemie“ mangels Kaufgelegenheiten erheblich mehr Geld zur Seite gelegt, als der Staat neue Schulden aufgenommen hat, um die Krise abzumildern. Diese Gelder sollen nun für Investitionen im nationalen Interesse mobilisiert werden. (Wieweit das realistisch ist, bleibt dahingestellt.)
Diesem Ziel dient wohl auch die Ankündigung des Investitionsplans „Frankreich 2030“ von 30 Milliarden Euro am 12. Oktober 2021 durch Emmanuel Macron. Der Plan sieht unter anderem den Bau von zwei Giga-Fabriken für die Herstellung von Wasserstoff mithilfe von preiswertem Atomstrom vor. Dieser gilt in Frankreich als „grün“, in Deutschland hingegen (noch) als „rot“. Frankreich soll durch die Umsetzung dieses Plans zum europäischen Marktführer für „grünen“ Wasserstoff werden. Hatte Macron kurz nach seinem Amtsantritt den mit ihm verbündeten Grünen noch versprochen, bis 2025 insgesamt 17 Kernreaktoren abzuschalten und den Anteil der Kernenergie am Strom-Mix von etwa 75 auf 50 Prozent zu senken, so ist nun stattdessen der Bau von sechs neuen Druckwasser-Reaktoren der vierten Generation im Gespräch. Daneben stellt das Programm erstmals eine Milliarde Euro für die Entwicklung von modularen Kleinreaktoren (SMR) zur Verfügung. Macron hat inzwischen die Regierungen weiterer 13 EU-Staaten um sich geschart, um die EU-offizielle Anerkennung der Kernenergie als „grün“ durchzusetzen. Wie man hört, hat er inzwischen sein Ziel fast erreicht.
RTE: Ausbau der Kernenergie ist der kostengünstigste Weg zu Net Zero
Am 25. Oktober 2021 veröffentlichte der französische Stromnetzbetreiber RTE seine lange erwartete Studie mit dem Titel „Futurs énergétiques 2050“ (Energiezukunft 2050). Diese Studie dient heute den Befürwortern eines Ausbaus der Kernenergie als gewichtiges Argument. Die Studie krankt allerdings daran, dass sie in ihrem Basis-Szenario – vermutlich unter dem Druck der in französischen Regierungskreisen einflussreichen deutschen Energiespar-Lobby – von einem unrealistisch niedrigen Strombedarf von lediglich 645 Terawattstunden (TWh) im Jahre 2050 ausgeht. Dieser läge damit nur um 35 Prozent über dem des Jahres 2019, d.h. vor der „Pandemie“. Vergleichbare Länder gehen hingegen von einem Strombedarfs-Zuwachs von 70 bis 80 Prozent aus. Die französischen Wissenschafts- und Technik-Akademien waren dem entsprechend von einem Strombedarf von 800 bis 900 TWh ausgegangen. RTE rechnet stattdessen mit einer großen Zunahme der Energieeffizienz. Diese lag jedoch in den vergangenen 20 Jahren immer unter jährlich einem Prozent und nichts weist zurzeit darauf hin, dass sich das in den kommenden 30 Jahren ändern könnte.
Immerhin gelangt auch die Hypothese „Réindustrialisation profonde“ der RTE-Studie zu einem Strombedarf von über 750 TWh. Frankreich brauche im Jahre 2050 eine Kernkraft-Kapazität von 50 Gigawatt, um das Ziel der tiefen Reindustrialisierung erreichen zu können. Das Ziel der Kohlenstoff-Neutralität der Stromversorgung sei mithilfe des Ausbaus der Kernkraft-Kapazität überdies mit jährlich schätzungsweise 59 Milliarden Euro deutlich günstiger zu erreichen als mit einem Strom-Mix, der von Wind und Sonne dominiert wird. Dieser würde jährlich schätzungsweise 77 Milliarden Euro verschlingen und obendrein einen erheblichen Ausbau des Stromnetzes erfordern. Ganz abgesehen von dem im Vergleich zur Kernkraft riesigen Flächenbedarf von Wind- und Solaranlagen.
Wenn Frankreich sich für den Ausbau der Kernenergie entscheidet, muss es saisonal überschüssige Elektrizität bei Bedarf kostengünstig exportieren können. Als Frankreich im März 2002 unter der Kohabitations-Regierung Chirac/Jospin seinen Strommarkt nach langem Widerstand endlich öffnete, einigte man sich auf dem EU-Gipfel von Barcelona auf zwischenstaatliche Netz-Verbindungen, deren Kapazität 10 Prozent der jeweiligen einzelstaatlichen Gesamtkapazität nicht überschreiten sollte. Bislang ist dieses Niveau nach Aussage des hier schon öfters zitierten Samuel Furfari, einem ehemaligen Spitzenbeamten der EU-Direktion Energie, nie erreicht worden. Im Gegenteil hat nach Ansicht Furfaris die von Angela Merkel wenige Jahre später beim damaligen EU-Präsidenten Barroso durchgesetzte verbindliche Förderung und vorrangige Einspeisung von Strom aus „erneuerbaren“ Energiequellen die Entwicklung eines einheitlichen europäischen Strommarktes im Keim erstickt. Die weitere Entwicklung des europäischen Strommarktes hänge nun davon ab, ob die Kernenergie, die in der EU mit 28 Prozent zum Gesamtaufkommen der Elektrizitätserzeugung beiträgt (gegenüber nur 7 Prozent durch Wind und Sonne zusammengenommen), in der EU-Taxonomie der Finanzanlagen als „nachhaltig“ anerkannt wird.
Darüber tobt zurzeit, angeführt von den deutschen Grünen, ein heftiger Streit im EU-Parlament und in anderen Instanzen der EU. Die Grünen haben schnell kapiert, dass die Anerkennung der Kernenergie als „nachhaltig“ das jähe Ende ihrer Wunschträume bedeutet. Der Grüne Europa-Abgeordnete Sven Giegold bringt es auf den Punkt: „Das wäre der Super-GAU für Europas Energiewende“, sagte Giegold. Die Folgen wären auf dem Feld der Finanzen schnell spürbar: „Das Ergebnis wäre eine Entwertung aller neuen Finanzprodukte, die den Green Deal in Europa voranbringen sollten.“ Stattdessen werde dann mehr öffentliches und auch privates Kapital in Richtung neuer Kernkraftwerke gelenkt. Da es für sie nun also sozusagen um die Wurst geht, treten die Grünen umso aggressiver auf. Man darf gespannt sein, wie sich das in den in Berlin laufenden Koalitionsverhandlungen niederschlägt.
Über die nukleare Renaissance in Frankreich und Europa




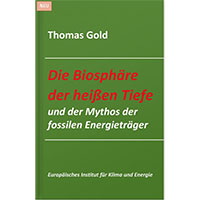
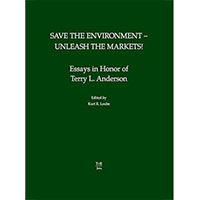
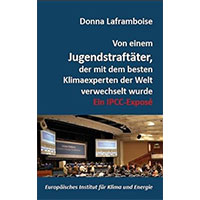
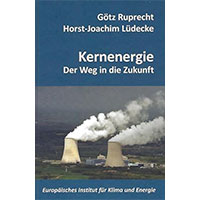
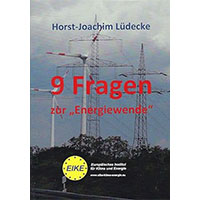
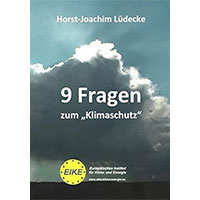
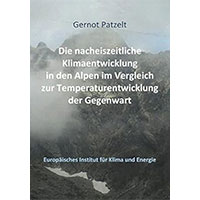
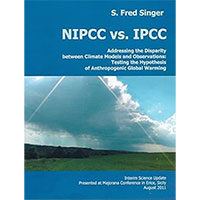
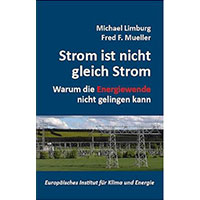
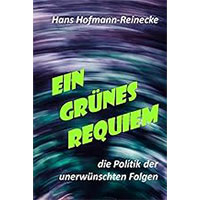


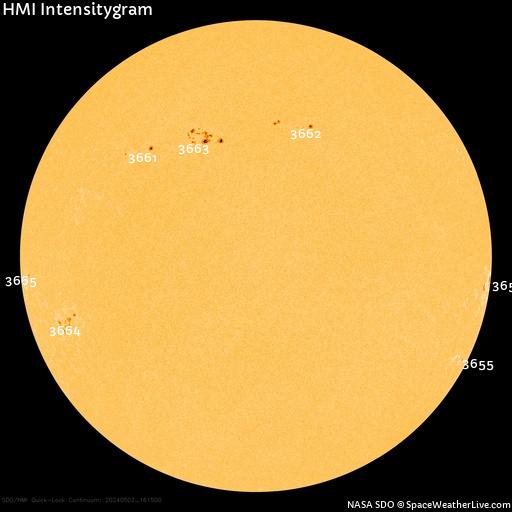
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
- Bitte geben Sie Ihren Namen an (Benutzerprofil) - Kommentare "von anonym" werden gelöscht.
- Vermeiden Sie Allgemeinplätze, Beleidigungen oder Fäkal- Sprache, es sei denn, dass sie in einem notwendigen Zitat enthalten oder für die Anmerkung wichtig sind. Vermeiden Sie Schmähreden, andauernde Wiederholungen und jede Form von Mißachtung von Gegnern. Auch lange Präsentationen von Amateur-Theorien bitten wir zu vermeiden.
- Bleiben Sie beim Thema des zu kommentierenden Beitrags. Gehen Sie in Diskussionen mit Bloggern anderer Meinung auf deren Argumente ein und weichen Sie nicht durch Eröffnen laufend neuer Themen aus. Beschränken Sie sich auf eine zumutbare Anzahl von Kommentaren pro Zeit. Versuchte Majorisierung unseres Kommentarblogs, wie z.B. durch extrem häufiges Posten, permanente Wiederholungen etc. (Forentrolle) wird von uns mit Sperren beantwortet.
- Sie können anderer Meinung sein, aber vermeiden Sie persönliche Angriffe.
- Drohungen werden ernst genommen und ggf. an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben.
- Spam und Werbung sind im Kommentarbereich nicht erlaubt.
Diese Richtlinien sind sehr allgemein und können nicht jede mögliche Situation abdecken. Nehmen Sie deshalb bitte nicht an, dass das EIKE Management mit Ihnen übereinstimmt oder sonst Ihre Anmerkungen gutheißt. Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, Anmerkungen zu filtern oder zu löschen oder zu bestreiten und dies ganz allein nach unserem Gutdünken. Wenn Sie finden, dass Ihre Anmerkung unpassend gefiltert wurde, schicken Sie uns bitte eine Mail über "Über Uns->Kontakt"Wie soll die wachsende Weltbevölkerung ernährt werden, wenn die Freisetzung von CO2 „mit Gewalt“ verhindert werden soll?
Da könnte man ja auch einer EU, die uns unterm Strich zwar ausnimmt, wieder etwas abgewinnen. Nämlich, wenn die grün und Klima-verdummten Weltretter mit Hilfe von Makron und einer EU-Mehrheit endlich zur Vernunft gebracht werden. Aus eigener Kraft hat D sowas noch nie geschafft. Deshalb hat eine EU auch Vorteile – man stelle sich D in der Mitte ohne EU vor: Es kämen dabei nichts als Dummheiten und Unberechenbarkeit heraus, was unsere Nachbarn fürchten.
Kernenergie liefert auch Prozesswärme für die Herstellung synthetischer Kraftstoffe, die Abwärme würde dadurch verringert. Man müsste dann nicht um jeden Preis die E-Mobilität erzwingen. Und der Markt bekäme dann auch eine Chance. Aber in Absurdistan schwärmt man ja neuerdings von großer Transformation und grüner Staatsplanwirtschaft. Vielleicht graust es inzwischen auch Makron vor soviel Klima-Trotteligkeit bei seinem Nachbarn. Bei dem es noch keine Gelbwesten gibt, was höchst erstaunlich ist.
Ich war selbst lange Zeit sehr pro EU, weil ich mir dachte, dass die deutschen Marotten sich in e1inem größeren Ensemble verdünnen werden. In der Tat verdanken wir eine Reihe von Liberalisierungen (ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen) der EWG bzw. der EU. In den letzten Jahren häuften sich allerdings freiheitsfeindliche Initiativen der EU. Die meisten davon kamen bei näherem Hinsehen allerdings nicht aus Brüssel oder Strasburg, sondern aus Berlin. Merkel und ihre Getreuen spielten über Bande, indem sie unpopuläre Maßnahmen als europäische Initiativen ausgaben. Ein Beispiel dafür ist die von mir erwähnte Road Map in Sachen „Erneuerbare“.
Wie zu erwarten war, hat die Debatte um die Kernenergie angesichts der Flatterhaftigkeit von Wind- und Sonnenstrom inzwischen Fahrt aufgenommen. Dabei werden von den Kernkraftgegnern als „letzte Trumpfkarte“ die vorgeblich bedeutend höheren Erzeugungskosten der Kernenergie im Vergleich zum Flatterstrom ins Feld geführt. Dies ist sachlich bzw. betriebswirtschaftlich nicht korrekt:
Das zentrale Argument für die Kernenergie ist -neben deren CO2-Armut- ihre ständige und sichere Verfügbarkeit. Sie hat Ernergie-wirtschaftlich also die Rolle eines „Back-Up“ für die unzuverlässige Stromerzeugung über Solarzellen oder Windturbinen. Zur gesamtwirtschaftlich sicheren Stromversorgung ist bei noch so gewaltigem Ausbau von Solar- und Windstrom eine verlässliche und ständig verfügbare Stromquelle unabdingbar. Da Gas-, Erdöl- und Kohlestrom wg. CO2 unerwünscht sind, ist Strom ein zwangsläufiges Koppelprodukt zur Flatterstromerzeugung, um katastrophale Black-Outs während der berühmten „Dunkelflauten“ abzuwenden.
M. a. W.: Die Stromerzeugung über Kernspaltung ist -zur Zeit- die einzige Möglichkeit, die Gesamtversorgung mit Strom zu sichern, die sich in ihrem unsicheren Teil auf Wind und Sonne stützt.
Es gibt keine andere Wahl: Kernenergie und „Erneuerbare“ sind aus Gründen der Versorgungssicherheit untrennbar miteinander verbunden. Sie sind Koppelprodukte, deren Herstellungskosten nur gesamt, nicht jedoch getrennt für die beiden Teile „Erneuerbare“ versus „Kernstrom“ berechnet werden können.
„Kernenergie und „Erneuerbare“ sind aus Gründen der Versorgungssicherheit untrennbar miteinander verbunden. Sie sind Koppelprodukte, deren Herstellungskosten nur gesamt, nicht jedoch getrennt für die beiden Teile „Erneuerbare“ versus „Kernstrom“ berechnet werden können.“
Das gilt auch für Kohle/Gasstrom in Verbindung mit Ökodeppenstrom.
Kalkuliert man die Koppelsituation kommt man sehr schnell drauf, daß der völlige Verzicht auf den Zufallsstrom die preisgünstigste Variante ist
Stell dir vor, du bist kurz vor dem Ziel mit einer untauglichen Lösung richtig Kasse zu machen. Und dann kommt einer mit tauglichen Lösung. Wäre blöd, gell? 😆
Der Hinweis: „Das Ergebnis wäre eine Entwertung aller neuen Finanzprodukte, die den Green Deal in Europa voranbringen sollten.“
scheint mit sehr realistisch zu sein. Wenn allerdings mit Kernkraft für Soros mehr Geld zu verdienen wäre, wäre es mit den Klimaterroristischen Gruppen auch schnell vorbei.
@Herr Dr. Demming: der bösartige Georg ist ja ein Menschen- und explizit ein Deutschenhasser (er hat in einem kleinen Video verkündet „die Grünen sind die letzte Hoffnung“), der hat ganz andere Ansinnen mit den Scheiß-Windrädern…. Man muß sich hier in der BRD – seit die Primärpsychopathen so exzessiv in die Energieerzeugung, die Telekommunikation, das Wetter, die Medizin, die Nahrung, demnächst auch in das Wasser, die Natur und schlicht überall reinfunken – ständig seines Lebens erwehren; ich frage mich nur, warum dem Niemand schon längst den Garaus gemacht hat? Der hat schon so viel Unheil angerichtet, das wäre doch nur logisch 🙂 Er müßte als Opfer an die Götter dargebracht werden, schnellstmöglich 🙂
Klar geht es für die Grünen um alles:
wenn Kernenergie genutzt wird, dann mach es überhaupt keinen Sinn noch ein einzelnes PV oder Windrad aufzustellen!!!
In der Tat bewirken die Zappelanlagen NUR das weniger Kernbrennstoff genutzt wird. Nur spielt dieser im Strompreis keine Rolle. Auch wenn der Preis dafür sich verzehnfachen würde (ab diesen Preis kann dann dieser sogar aus dem Meerwasser gefiltert werden!!!).
Das bedeutet, dass Zappelstromanlagen ab da Mause TOT sind. Die bringend nichts außer Kosten, Umweltschäden und Riesige Netzkosten für Ausbau und Netzt Stabilisierung…
Die Kernkraftbranche sagt zwar das Kernkraft und Wind/Solar sich ergänzen, aber die wissen genau, dass das nur ein Argument ist, um die Erregten Grünen zu beruhigen.
Wenn man schon meint, CO2 Neutral Wirtschaften zu müssen gibt es nur eine Lösung derzeit (ohne zurück in die Höhle kriechen zu müssen): ein Mix aus Kernkraft und Spitzenlast Gaskraftwerke. Morgen ggfls. Kernfusion.
Punkt, alles andere ist Bullshit.
Die Grünen dürfen sich daher berechtigte Sorgen machen, nur ist es halt so dass es keine Alternative ist, es sein denn wird machen die Wirtschaft dicht oder lassen in Sachen Klimawandel mal die Kirche im Dorf.
Den einzigen Rettungsanker den die Grünen haben, währe wenn einer von denen mal sagt: „Hey Kernkraft ist absolut schlecht, AAABER die SMR, Dual Fluid sind ja was GAAANZ anderes und der richtige Weg“. Dann könnte die sogar gestärkt aus der Lage rauskommen.
Ich vermute aber, dass die Grünen dafür viel zu borniert sind und teilweise wie Verarmung der Bevölkerung sogar als erwünschtes Ziel sehen.
Bitte hier nur unter vollem Klarnamen posten.