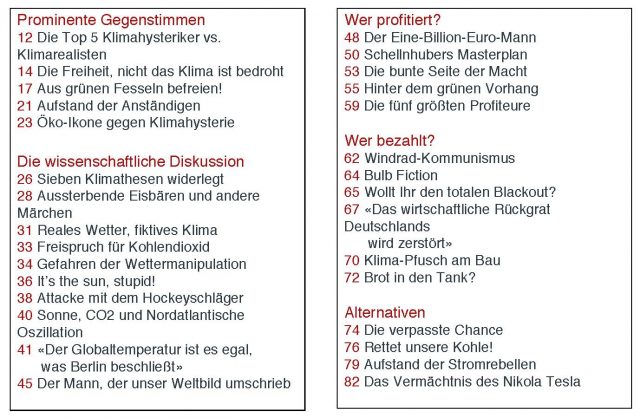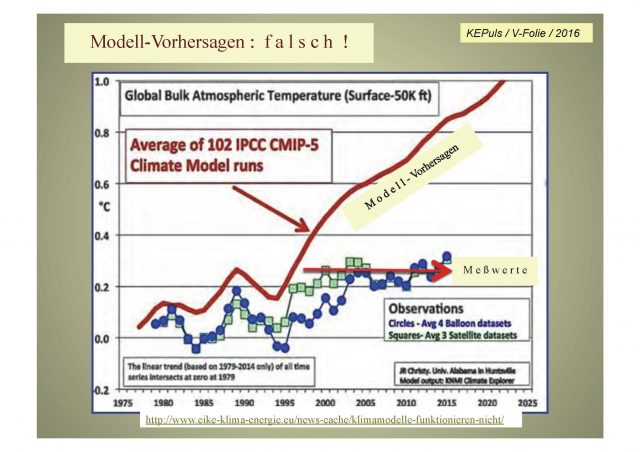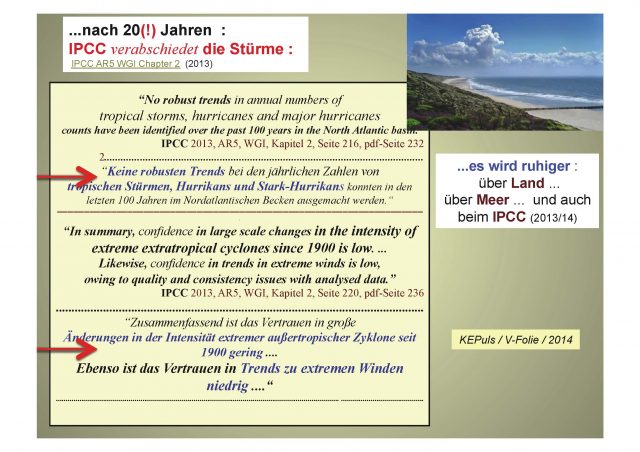Meteorologischer Kalender 1982-2018: Der Weg vom Fachblatt zur Klima-Katastrophen-Postille !
Wolfgang Thüne
Auch nach 36 Jahren beeindruckt der Meteorologische Kalender 2018 [1] wieder durch spektakuläre Fotos mit Motiven, die das Wetter in seiner schier endlosen Mannigfaltigkeit präsentiert. Für die etwa 1800 DMG-Mitglieder sind die Erklärungen auf den Kalenderrückseiten eigentlich überflüssig, doch für interessierte Laien könnten sie etwas verständlicher und ausführlicher sein. Schließlich erhebt die DMG den hohen Anspruch, „das Interesse an den Vorgängen der Atmosphäre zu fördern und meteorologisches Fachwissen zu verbreiten“. Angesichts des Jubiläums „150 Jahre Norddeutsche Seewarte“ Hamburg wurde das Thema „Atmosphäre und Ozean“ gewählt.
So schön die Fotos sind, so kritikfähig sind die ausgewählten Texte und versprechen Ärger für Inge Niedek, die Vorsitzende der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft DMG und Ex-Wettermoderatorin des ZDF. Unter der Überschrift „Wetter und Meer“ folgt „Ozean und Klima“ und „Den Einfluss des Ozeans auf Klima und Wetter erfahren wir…“ Das ist eine Verdrehung der Fakten und bewusste Herabsetzung der Meteorologie als Hilfswissenschaft der Klimatologie im Namen der politischen Korrektheit. Jeder weiß, dass das Klima vom Wetter abgeleitet und damit ein Definitionskonstrukt des Menschen ohne Eigenexistenz ist. Mit anderen Worten: Die Natur kennt nur Wetter und mittelt dieses nicht zu Klima. Es gibt den „vom Menschen verursachten Klimawandel“ nicht. Der „Klimawandel“ ist Folge des natürlichen und unaufhaltsamen Wetterwandels. Die Klimavielfalt auf der Erde ist Folge der Wettervielfalt und diese bestimmt wiederum die Vegetationsvielfalt.
Der Kalender steckt voller Ungereimtheiten. Nur zwei Beispiele: „Durch Abkühlung an der Meeresoberfläche wird kaltes und schweres Tiefenwasser gebildet, das bis in Tiefen von 100-2000 m absinkt.“ Doch wenige Zeilen später lesen wirr staunend, dass „sich der subpolare Nordatlantik in der Tiefe langsam erwärmt“. Ein anders Beispiel: „Von den Ozeanen verdunstet jedes Jahr eine etwa einen Meter dicke Schicht Wasser.“ Das sind 1000 mm! Bei der Höhe des Meeresspiegels heißt es in der „peer-revievten Literatur“, dass er seit Beginn des 20. Jh. um ca. 1,5 mm und seit den 1990er Jahren um ca. 3,2 mm pro Jahr angestiegen sei, obgleich die Messgenauigkeit der Satelliten nur 20-50 mm betrage. Wer zu exakt sein will, wird rasch beim Mogeln erwischt. Des weiteren fehlt sowohl beim globalen Meeresspiegel wie bei der Globaltemperatur ein Bezugspunkt, ein simpler „Ausgangswert“!
Das Februarblatt behandelt den „Wärmeinhalt der Ozeane“. Sie werden als „Gedächtnis“ und als „energetischer Puffer“ im Klimasystem der Erde bezeichnet, als ob kontinentale Gesteine keine Wärme speichern könnten. Bei ihnen geht die Erwärmung, aber auch die Abkühlung nur schneller. Ein Skandal ist eine Abbildung mit der Bilanz zwischen Ein- und Ausstrahlung. Zur Erläuterung heißt es ohne Beweis: „Die Gleichgewichte von ein- und ausgehenden Strahlungsflüssen über den Oberrand der Atmosphäre spielen eine entscheidende Rolle für das Klimasystem“. Das ist Klima-Ideologie pur!
Nur eine Zwischenfrage: Wer liefert die ungeheure Energie, um jährlich eine etwa ein Meter dicke Wasserschicht der Ozeane zu verdunsten? Dadurch werden die Ozeane abgekühlt, doch die latente Wärme geht nicht verloren, sondern wird wieder bei der Kondensation des Wasserdampfes freigesetzt und gibt den Wolken thermischen Auftrieb. Zwischen der kurzwelligen sichtbaren Solarstrahlung und der infraroten Wärmestrahlung der Erde kann es noch aus weiteren Gründen kein „Gleichgewicht“ geben. Es herrscht genauso ein „Gleichgewicht der Strahlungsflüsse“ wie z. B. zwischen einer glühenden Herdplatte und einer Hand. Eine Berührung lässt den Irrglauben sehr schmerzhaft spüren. Die beiden Strahlungsflüsse sind extrem ungleichgewichtig, besonders was die Arbeitsfähigkeit betrifft. Dies steht in jedem Lehrbuch, lernt jeder Student der Meteorologie schon in den ersten Semestern. Solcherart Märchenerzählungen von „Meteorologen für Meteorologen“ sind eine inakzeptable Zumutung. Geht dieser politischen Wunschvorstellungen hörige Trend in der DMG so weiter, dann ist das AUS des Meteorologischen Kalenders bald abzusehen. Schade für die einst so tolle Idee von Werner Wehry und Walter Fett!
So farbenfroh der Meteorologische Kalender Monat für Monat auch sein mag, er kann als „wissenschaftliche Lektüre“ nicht empfohlen werden, wohl aber als Postkartenkalender.
[1] E. Schweizerbart’sche Verlags-Buchhandlung, Stuttgart 2017; Wandkalender ISBN 978-3-443-01092-8; 19,90 Euro; Postkartenkalender ISBN 978-3-443-01093-5; 10,80 Euro