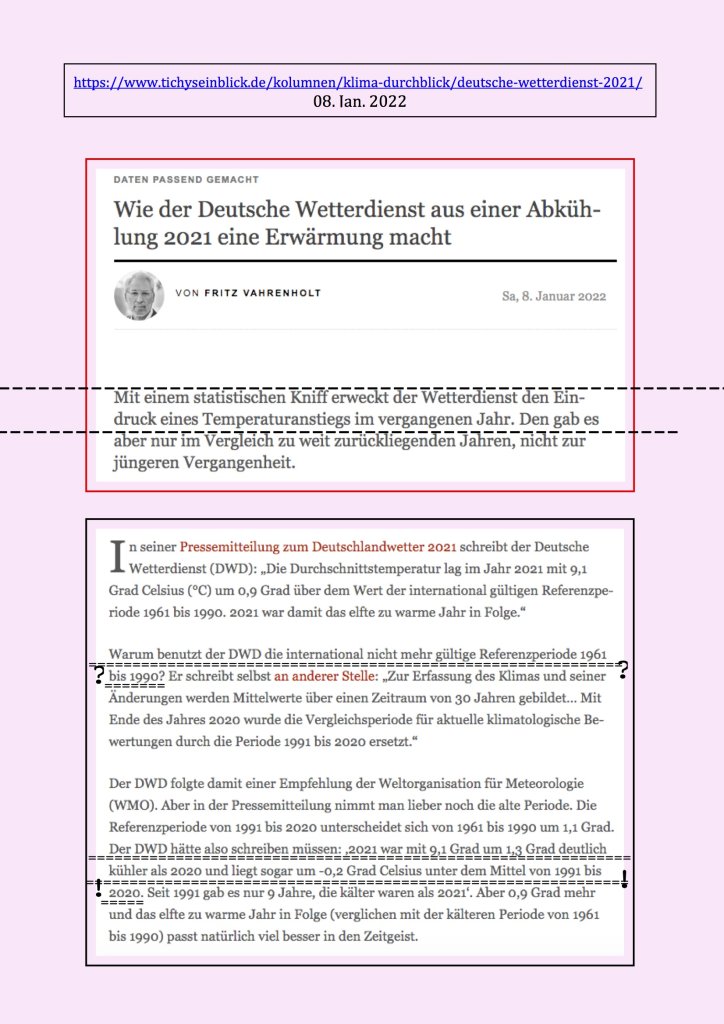Bis vor rund fünf Jahren war die Frage „Trog oder Teller“ in der Diskussion um die Erneuerbaren Energien noch hochaktuell. Nachdem die EU 2000 den Startschuss für den geförderten Anbau von Energiepflanzen im Rahmen des Erneuerbare- Energien-Gesetzes (EEG) abgegeben hatte, vielen seinerzeit ganze Landstriche der „Vermaisung“ anheim.
Im Zuge des neuen Solar-Booms nach Jahren der Stagnation müssen sich Ortsgemeinden im ganzen Land zunehmend mit den Angeboten und Flächenbeanspruchungen von Photovoltaik(PV)-Unternehmen auseinandersetzen. Mitarbeiter der PV-Projektierer, sogenannte Experten-Teams, halten permanent Ausschau nach potentiell „geeigneten Freiflächen“ für die Errichtung von Solaranlagen. Sie führen Verhandlungsgespräche mit den verantwortlichen Kommunalpolitikern und Landeigentümern, darunter zahllose Bauern in wirtschaftlich prekärer Situation, denen hohe Pachtpreise in Aussicht gestellt werden.
Die stark gefallenen Preise für Solarmodule haben dazu geführt, dass sich für Investoren insbesondere sehr große PV-Anlagen auch nach dem Ende der EEG-Förderung rechnen. Die neuen Projekte zielen daher oft auf Ackerflächen von 100 und mehr Hektar. Vor dem Hintergrund der allgegenwärtigen Klimadebatte scheint jedoch die Konkurrenz zwischen der Nahrungs- und Futtermittelproduktion einerseits und der flächenraubenden Solarstromerzeugung paradoxerweise kein besonders wichtiges Thema zu sein.
Eigentlich müsste jetzt in den Regionen die Sorge über Verluste der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Vordergrund stehen, doch darüber lässt sich nur wenig in Erfahrung bringen. Die medial dominierende Klimadebatte mit dem erklärten politischen Ziel eines exponentiell steigenden Zubaus sowohl der Windkraft als auch der PV-Freiflächenanlagen überlagert alle damit zusammenhängenden Themen.
Sogar Naturschutzbelange werden unter dem Druck der allgegenwärtigen Klimadebatte für nachrangig erklärt, jetzt auch nach offizieller Richtlinie der neuen Bundesregierung.
Bürgeraufstand in Pronstorf
Auch über andere kritische Entwicklungen informieren die etablierten Medien die Öffentlichkeit kaum in Verbindung mit der rasant fortschreitenden Quasi-Bodenversiegelung durch PV-Parks: steigende Pachtpreise aufgrund der Solar-Konkurrenz, Entzug von Äckern und Grünflächen für die Nahrungs- und Futtermittelproduktion auf Jahrzehnte hinaus, verkleinerte Lebensräume, weniger Niststätten, Rastplätze und ein reduziertes Nahrungsangebot für Vögel, Kleintiere und Insekten sowie soziale und menschengerechte Belange wie der Schutz von Lebensqualität und der Werterhalt von Immobilien.
In der schleswig-holsteinischen Gemeinde Pronstorf im Kreis Segeberg (1620 Einwohner) sollte eine 90 Hektar große Photovoltaikanlage errichtet werden, was einer Fläche von mehr als 120 Fußballfeldern gleichkäme. Bis zu 20.000 Haushalte hätten laut dem Hamburger Projektentwickler Enerparc A.G. mit dem Solarstrom versorgt werden können. Vorhabenträger vor Ort ist der Großgrundbesitzer Hans-Caspar Graf zu Rantzau, der den Solarpark auf einem Teil seiner landwirtschaftlichen Flächen errichten wollte. Wie üblich lautete das Mantra der Befürworter, allen voran der Bürgermeisterin, dass die PV-Anlage Pronstorfs Beitrag zur Energiewende werden solle.
Gegner des Projekts argumentierten, dass Photovoltaikanlagen zumal von einem derartigen Umfang nicht auf landwirtschaftliche Felder gehören. Hinzu kam, dass die Gemeinde wie auch andere Gemeinden im Kreisgebiet bereits schlechte Erfahrungen nach der Errichtung des ehemaligen BayWa-Windparks Obernwohlde gemacht hatte. Die versprochenen anteiligen Gewerbesteuern waren aufgrund eines gängigen Steuersparmodells des Investors ausgeblieben.
Dennoch hatte der Pronstorfer Gemeinderat bereits vor einem Jahr grünes Licht für das Solar-Projekt gegeben. Daraufhin organisierten einige Bürger eine Unterschriftenaktion mit dem Ziel, den massiven Eingriff in ihre heimatliche Umwelt doch noch zu verhindern. Auf die bürgerliche Gegenwehr wurde der Bundesverband Solarwirtschaft aufmerksam. Im April unterbreitete daraufhin der Bundesverband Erneuerbare Energien e.V. dem damaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier den Vorschlag, betroffenen Gemeinden die „legale Möglichkeit“ einer Gewinnbeteiligung an der Stromerzeugung durch PV-Parks zu ermöglichen. Bereits im Juni bestätigte der Bundestag einen neuen Paragrafen im EEG 21, wonach die Betreiber von Windparks „zur Steigerung der Akzeptanz“ der Bürger künftig bis zu 0,2 Cent je erzeugter Kilowattstunde an die Kommunen abgeben dürfen.
NABU und BUND auf Tauchstation
Der Koalitionsvertrag sieht nun vor, dass dieses Verfahren auf bestehende und zukünftige Anlagen (Wind und Sonne) angewendet werden kann. Offenbar auf dieser Grundlage wurde der Gemeinde Pronstorf kurzfristig eine jährliche Gewinnbeteiligung bis zu 200.000 Euro angeboten.
Die Bürger ließen sich jedoch mehrheitlich nicht „kaufen“. Anfang Dezember lehnten sie in der von ihnen durchgesetzten Abstimmung mit einer Stimme Mehrheit die geplante gigantische Industrialisierung ihres Gemeindegebietes ab. Das Projekt soll jedoch vorerst nur auf Eis gelegt sein.
In zwei Jahren will Graf Rantzau zusammen mit Enerparc einen erneuten Versuch starten, um das Großprojekt in der Gemeinde und anschließend über eine Solarausschreibung doch noch durchzubringen.
Paradoxerweise prangern trotz der bedenklichen Entwicklung nur noch einige regionale Bauernverbände die in den Hinterzimmern verabredete Zweckentfremdung und Kapitalisierung der Agrarlandschaft an. Warnen die Umweltverbände NABU und BUND einerseits ihrem Auftrag gemäß vor einem rasant fortschreitenden Flächenverlust durch Bodenversiegelung aufgrund von Infrastrukturprojekten sowie durch Bau- und Gewerbegebiete, so erklären sich die mit den obersten Etagen der Landes- und Bundespolitik eng vernetzten Spitzenfunktionäre beider Verbände andererseits einverstanden mit einem „naturverträglichen Ausbau“ der Wind- und Solarenergie gemäß den Kriterien der EU. Diese sehen vor, dass dafür nur Flächen mit hoher Vorbelastung und Flächen, die keinen hohen ökologischen Wert besitzen, in Frage kommen.
Unvereinbar mit dem Naturschutzanliegen beider Verbände ist dabei nicht nur die Hinnahme der geplanten weitreichenden Industrialisierung von Agrarland und sonstigen Freiflächen – zumal der Interpretationsspielraum für derartige Richtlinien erkennbar groß ist. Hinzu kommt, dass NABU und BUND von der Politik die noch immer ausstehenden Studien über das Ausmaß des Vogelschlags und des Insektensterbens an Windrädern und überhitzten Solarkollektoren nicht einfordern – nicht einmal vor dem Hintergrund des fortschreitenden Insektensterbens, bei dem „ganz unerwartet“ eine kritische, unsere Existenz bedrohende Marke überschritten werden könnte.
Bei näherem Hinschauen erkennt man jedoch in der Solarenergie als einer Hauptenergiequelle für „grünen Strom“ im politischen Klimaschutzmodell ein rein lukratives, „grün gewaschenes“ Geschäftskonzept, das dem Ziel des „Klimaschutzes“ und des Umweltschutzes diametral entgegensteht. „Greenwashing“ betreiben Solarverbände ganz unverblümt, indem sie sich versuchsweise das Thema Naturschutz zu eigen machen und die fragwürdige Behauptung in Umlauf bringen, dass Solarparks durch eine „saubere Energieproduktion“ einen Mehrwert nicht nur für den „Klima-“, sondern auch für den Naturschutz erbringen könnten, da unter den aufgestellten Solarpaneelen auf Pestizide und mineralische Dünger wie beim Getreideanbau verzichtet würde. Ausgelaugte Böden könnten sich erholen und zwischen den Solarpaneelen könnten „Bienenparadiese“ entstehen.
Die Warnung des „Gaia“-Propheten
Davon kann jedoch keine Rede sein, im Gegenteil: Es muss endlich geklärt werden, in welchem Umfang Solardächer- und -parks in den Sommermonaten zur tödlichen Falle für Insekten werden, da die Solarmodule um 30 bis 40 Grad heißer werden als die Umgebungstemperatur. Das landwirtschaftliche Portal agrarheute.com verlangt auch Aufklärung über das noch immer ungeklärte Vogelsterben in Solarparks. In den USA werden einige Anlagen im Auftrag der Projektbesitzer nach toten Vögeln abgesucht. Diese Unternehmen haben jedoch weder in den USA noch hierzulande Interesse daran, dass alarmierende Zahlen zustande kommen und bekannt werden. Andernfalls hätte die Bundesregierung hierzu längst eine Studie in Auftrag gegeben.
Zudem wird mit der Abdeckung der Böden durch lange Reihen von Sonnenkollektoren die natürliche Atmung der Vegetation unterbunden, da der Gasaustausch zwischen Boden und Atmosphäre nur sehr reduziert stattfinden kann. Durch die Verhinderung der sogenannten Verdunstungsabkühlung und der nächtlichen Abkühlung entstehen durch Solarparks Wärmeinseln mit einer um drei bis vier Grad Celsius höheren Temperatur als in freier Natur, was eine Studie von sechs Forschern um den Hauptautor Greg Barron-Gafford von der School of Geography & Development der University of Arizona in Tucson 2016 nachgewiesen hat.
Die Kehrseite nicht nur der Windkraft, sondern auch der „unschuldigen“ Solarenergie hat der profilierte US-Atmosphärenphysiker Lee Miller in seinem Aufsatz „The Warmth of Wind Power“ auf den Punkt gebracht:
„Alle erneuerbaren Technologien wirken sich auf das Klima aus, da sie bei der Stromerzeugung Wärme, Impuls und Feuchtigkeit zur Stromerzeugung umverteilen, und zwar vollkommen unabhängig vom Klimawandel.“
Ein in die Zukunft verschobenes Kardinalproblem sowohl der expandierenden Wind- als auch der Solarenergie stellt auch die ungeklärte fachgerechte Entsorgung immer größerer Berge von ausgedienten Windrädern und Sonnenpaneelen mitsamt den darin enthaltenen Giftstoffen dar – ein weiterer Posten in der Liste der externen Kosten der Erneuerbaren Energien.
Der 102-jährige Biophysiker James Lovelock, einer der Gründerväter der grünen Bewegung, „Gaia“-Autor und Ehrendoktor der Universität Edinburgh, erklärte im Januar 2020 in einem „Spiegel“-Interview:
„Wir haben in bestehende natürliche Systeme eingegriffen, und das zieht immer unbeabsichtigte Nebenwirkungen nach sich. Unser Wissenschaftssystem ist aber nicht darauf ausgelegt, die Gesamtzusammenhänge zu erfassen. Auf der Universität lernen die Studenten nur, wie man ein Examen macht.“