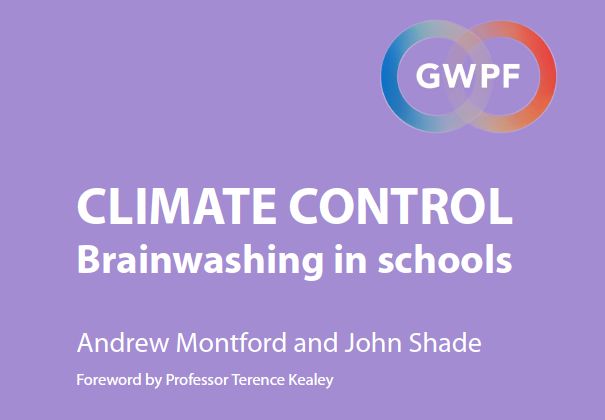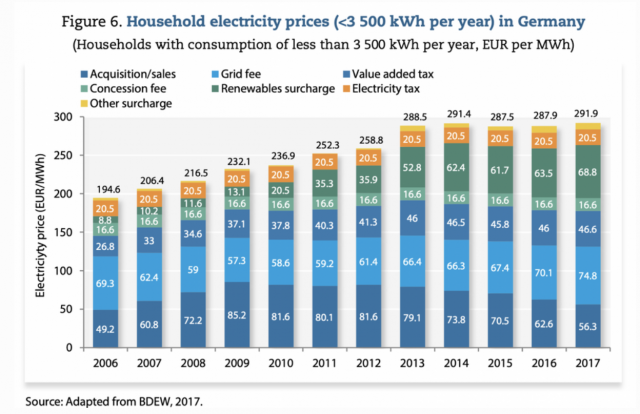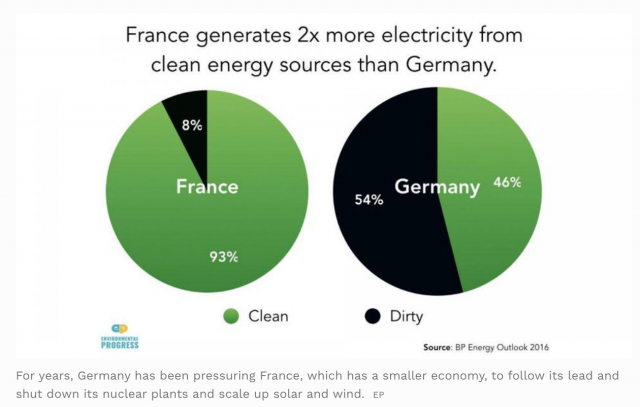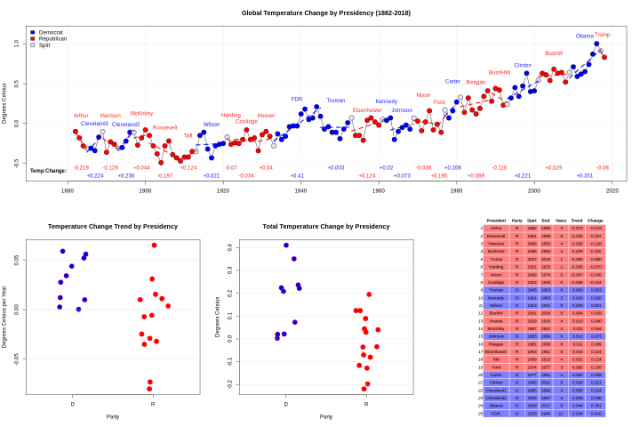Vorwort von Prof. Terence Kealey
Politiker und politische Aktivisten wollten aus nahe liegenden Gründen schon immer die Schulen unter Kontrolle haben. Vielleicht oder vielleicht auch nicht hat Francis Xavier von den Jesuiten gesagt „gebt mir das Kind, bis es sieben Jahre alt ist, und ich gebe euch den Mann zurück“. Aber viel zu viele Politiker wollten das Kind haben, bis es 17 Jahre alt war, nur um sicherzugehen.
In dieser eindrucksvollen Studie haben Andrew Montford und John Shade gezeigt, wie effektiv der Öko-Aktivismus die Lehrpläne unserer Schulen korrumpiert hat. Natürlich ist es richtig, dass der Treibhauseffekt auf realer Physik beruht, aber eine noch bessere Physik lehrt, dass der Globus ein komplexes System ist und dass viele verschiedene Effekte – nicht nur der Treibhaus-Effekt – das Klima beeinflussen. Und da wir nach wie vor das Klima der Erde nicht vertrauenswürdig modellieren können, müssen wir hinsichtlich der Sicherheit, mit der Öko-Aktivisten die Lehrpläne der Schulen beeinflussen wollen, sehr vorsichtig sein.
Wie Montford und Shade gezeigt haben, ist Öko-Aktivismus nur das jüngste Beispiel unablässiger Versuche seitens politischer Aktivisten, Lehrpläne der Schulen zu korrumpieren. Also müssen wir Institutionen schaffen, um die Schulen vor derartigen Aktionen zu schützen. Montford und Shade haben die schrecklichen Beispiele der Bildung unter den kommunistischen Regimes von Osteuropa und China angeführt, womit sie den einzigen Weg in eine solide Zukunft aufzeigen: Demokratie.
Bildungsforscher wie EGWest und James Tooley haben gezeigt, was für ein Fehler die Nationalisierung der Schulen in England und Wales im 19. Jahrhundert war. …
Aber die Nationalisierung der Schulen ist jetzt effektiv unumkehrbar. Wie also können wir die Lehrpläne schützen? Ein Vorbote ist die Statistik-Behörde in UK. Sie wird zwar von der Regierung finanziert, sendet ihre Berichte aber nicht an einen Minister, sondern direkt an das Parlament. Folglich ist dessen Unabhängigkeit optimiert. Vielleicht brauchen wir jetzt eine Lehrpläne-Behörde, welche dem Parlament via eines gewähltem Komitees Bericht erstattet. …
In der Zwischenzeit müssen wir dem Ruf von Montford und Shade folgen, eine unabhängige Bewertung unserer gegenwärtigen Klima-Lehrmeinung durchzuführen, denn falls die Schulen – wie es der Titel ihrer Studie nahelegt – eher Gehirnwäsche durchführen als zu bilden, haben wir ein Problem.
————————————–
Executive summary
Wir haben in den Lehrmaterialien der Schulen ernste Fehler, irreführende Behauptungen und erhebliche Verzerrungen gefunden, geschuldet einer völlig unzureichenden Behandlung von Klima-Themen. Darunter sind viele weit verbreitete Lehrbücher, Lehrer unterstützende Materialien und Schülerprojekte.
Wir fanden Beispiele dafür, wie sich Öko-Aktivismus in Schulen frei entfalten konnte und wie die Schulen ihren Schülern empfahlen, an den Veranstaltungen teilzunehmen. In jeder Hinsicht liegt die Betonung auf Ängsten oder steigenden Befürchtungen, gefolgt durch die Verbreitung gezielter Anweisungen, wie die Schüler leben sollten und sogar was sie denken sollen. In einigen Beispielen fanden wir die Ermutigung, ,kleine politische Aktivisten‘ in den Schulen heranzuzüchten, indem ihnen eine Last von Verantwortlichkeit für Maßnahmen ihrerseits aufgebürdet werden, den ,Planeten zu retten‘, nicht zuletzt dadurch, dass sie Druck auf ihre Eltern ausüben.
Der Nationale Lehrplan ist zwar kürzlich von der Regierung einer Überprüfung unterzogen worden, aber es ist unwahrscheinlich, dass die vorgeschlagenen Änderungen derartige Praktiken unterbinden.
Umfragen zeigen, dass viele Kinder erbost und geängstigt sind durch das, was man ihnen bzgl. des Klimas eingetrichtert hat.
Lehrer und Rektoren haben so ziemlich freie Hand bei der Auswahl von Lehrbüchern, anderen Materialien, Besuchern und Schulreisen, vorausgesetzt, sie passen zu den Zielen des Lehrplanes. Damit besteht das Risiko, dass Einige alarmierende und politisch befrachtete Quellen auswählen, um Kinder für die ,Causa Umwelt‘ zu gewinnen. Diese ,Causa‘ wird oftmals durch den Terminus ,Nachhaltigkeit‘ präsentiert, einem kaum definierten Schlagwort, mit welchem politische und persönliche Aktionen abgedeckt werden sollen, damit grundsätzliche Kritik daran gar nicht erst aufkommt. Viele Kampagnen von NGOs und anderen Organisationen mit Eigeninteressen wie Energie-Unternehmen bieten den Schulen Lehrmaterialien und andere Ressourcen an. Einige davon werden tatsächlich herangezogen.
Es gibt eindeutig Anlass für schwere Bedenken. Daher appellieren wir ernsthaft an die Bildungsminister in England, Schottland, Wales und Nordirland, die Bildung bzgl. Klimawandel an unseren Schulen dringend zu überprüfen. Nur eine systematische Evaluierung dessen, was vor sich geht, kann das Ausmaß der Indoktrination ans Tageslicht bringen, ebenso wie der emotionale und erzieherische Schaden, welcher den Schülern unzweifelhaft zugefügt wird.
Introduction
Die Korruption der Lehrpläne in Schulen als Unterstützung für eine radikale Sicht auf die Welt, welche fast mit Sicherheit der Mehrheitsansicht in unserer Gesellschaft widerspricht, wurde in einer Sammlung von Beiträgen beschrieben, herausgegeben von Robert Whelan. Einer der Autoren darin, der Soziologe Frank Furedi, argumentiert, dass der Lehrplan ,zunehmend als ein Vehikel herangezogen wird, um politische Ziele zu erreichen sowie die Werte, das Verhalten und die Gefühlswelt von Kindern zu verändern‘. Ein anderer Autor, der Geograph Alex Standish beschreibt, wie derartige Einmischungen ,sowohl junge Menschen zu unreifen politischen Subjekten als auch Erwachsene zu unabhängigen politischen Subjekten degradieren‘. Er folgert, dass niemand in der Lage ist, als unabhängiger Moralapostel zu agieren … mit anderen Worten, es gibt dabei die Mutmaßung moralischer und politischer Inkompetenz. Der Vorwurf der Inkompetenz wird klar, wenn man ein alternatives Verfahren betrachtet, mittels welchem die Schulen danach trachten Individuen hervorzubringen, die gebildet genug sind, um für sich selbst Entscheidungen zu treffen bzgl. des Gebrauchs von Low-Energy-Glühlampen, Radfahren zur Arbeit oder fossile Treibstoffe zu verbrennen, und bei dem die primäre Verantwortlichkeit dafür bei den Eltern verbleibt, ihren Kindern Werte zu vermitteln, und nicht umgekehrt.
…
Die Nachhaltigkeits-Agenda
Wie konnten wir dorthin kommen?
Der Anstoß dazu, Umwelt und Nachhaltigkeit in das Zentrum der Bildungsagenda zu rücken, kann bis zu Beginn der 1970ger Jahre zurückverfolgt werden. In diesen frühen Tagen der modernen Umweltbewegung kam die Stockholm-Konferenz der UN im Jahre 1972 zu dem Ergebnis, dass Umwelterziehung ,unabdingbar war, um die Grundlage für aufgeklärte Meinungen und verantwortliches Verhalten zu erweitern‘. 1976 wurden derartige Gedanken aufgegriffen, und auf einer internationalen Konferenz zum Thema Umweltbildung in Belgrad wurde ihnen der Weg gebahnt. Als Abschluss wurde die Belgrad-Charta herausgegeben, in welcher festgeschrieben worden ist, dass das Ziel der Umweltbildung die Entwicklung einer Weltbevölkerung war, die hinsichtlich der Umwelt gebildet war, welche starke Bedenken bzgl. Umwelt hatte sowie bzgl. der Motivation, an Schutz und Verbesserung der Umwelt mitzuwirken.
…
Conclusions
Es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass eine rigorose Bildung jetzt einer hoch politisierten Gehirnwäsche Heranwachsender bzgl. ,Klimawandel‘ Platz gemacht hat, wobei Ängste bzgl. Energie als Motivation und ,nachhaltige Entwicklung‘ als die Lösung präsentiert werden. Vorbei sind die Tage, als das Bildungssystem noch gehofft hatte, junge Menschen so zu bilden, dass sie sich ihre eigene Meinung bilden konnten hinsichtlich komplexer wissenschaftlicher, soziologischer und politischer Themen. Stattdessen trachtet das Bildungssystem jetzt danach, unterwandert von einer grün-politischen Bewegung, Konformität mit der umweltaktivistischen Orthodoxie herzustellen, wobei jede Infragestellung derselben als Störungen abgetan werden, die man ignorieren oder mit Verachtung strafen kann.
Die Bedeutung dessen, was wir gesehen haben, kann gar nicht überschätzt werden. Die Tatsache, dass die Fähigkeit der Kinder, Prüfungen zu bestehen – und damit ihre zukünftigen Lebensaussichten – abhängig ist von ihrer Fähigkeit, ihr Befolgen der Klimawandel-Orthodoxie zu zeigen, erinnert schmerzhaft an das Leben der kommunistischen Ära in Osteuropa oder Maos China. Politiker scheinen diesen Prozess abgesegnet zu haben, indem sie viele Lehrinhalte grünen Aktivisten zu formulieren überlassen haben. Die Frage, was in den Klassenräumen gelehrt wird, sei dies nun wissenschaftlich oder politisch, ausgeglichen oder verzerrt, wahr oder falsch, scheint überhaupt keine Rolle mehr zu spielen.
Das Bildungsgesetz aus dem Jahr 1996 hatte eindeutig zum Ziel, die Kinder vor einseitiger politischer Indoktrination zu schützen. Es wurde erfolgreich angewendet durch ein Gerichtsverfahren, mit welchem die Propaganda in dem Film An Inconvenient Truth an Schulen verboten worden ist. Aber die fast einheitliche Haltung der großen politischen Parteien könnte die Verbreitung der Ansichten, die wir in diesem Report aufgedeckt haben, sanktioniert haben. Allerdings könnte sich auf der politischen Bühne jetzt eine Änderung dahingehend abzeichnen, dass das Ausmaß, mit dem relevante Abschnitte des Gesetzes respektiert werden, neu untersucht werden.
Eltern von Schulkindern und andere betroffene Individuen sind angesichts dieses Problems nicht hilflos. Das Buch mit dem Titel [übersetzt] „Fakten, keine Furcht“ der amerikanischen Autoren Michael Sanera und Jane S. Shaw schildert viele Beispiele schlechter Lehrmaterialien für Kinder bzgl. Umwelt, aber es enthält auch viele Vorschläge, was man dagegen tun kann. Ihre grundlegende Aussage ist, dass derartige Materialien „nur eine Seite einer oftmals komplizierten Story zeigen“ und dass Eltern den Lehrplan einer Schule überprüfen sollten, indem sie ein paar allgemeine Fragen stellen wie „gibt es darin eine durchgehende Verzerrung gegen ökonomisches Wachstum und moderne Technologie?“ oder „Ist die Darstellung von Umweltproblemen alles in allem düster und pessimistisch?“ und „werden die Kinder verängstigt, damit sie zu Umwelt-Aktivisten werden?“. Die Autoren regen an, die Lehrbücher zu durchforsten und die Begleitmaterialien zu prüfen einschließlich Beiträge von Gastbesuchern. Sie drängen die Eltern, mit den Lehrern ihrer Kinder zu reden und die Problematik in freundlicher, nicht konfrontativer Art anzusprechen. Eltern sollten auch selbst Gastredner zu Besuchen an der Schule einladen oder tatsächlich auch selbst vor den Kindern vortragen, sofern sie über das Wissen bzgl. relevanter Themen verfügen. Auch könnten die Eltern andere Bücher für die Schulbibliothek besorgen und sich mit anderen Eltern zusammentun, um bei der Schule und entsprechenden Behörden vorstellig zu werden. Schließlich sollten Eltern selbst mit ihren Kindern Umweltthemen erforschen und – sehr wichtig – den Tenor von Sicherheit und Untergang aus den Lehrtexten herausnehmen.
Erweitert man die Perspektive, dann zeigt sich das Risiko, in unserem wissenschaftlichen und technologischen Zeitalter ein zentrales Element in einer gesunden Gesellschaft zu schwächen: nämlich die Fähigkeit der Bürger, sich eine eigene Meinung zu bilden hinsichtlich Themen wie Klimawandel. … Vor Organisationen wie dem WWF die Knie zu beugen ist nicht der richtige Weg. Vielmehr müssen diese Organisationen herausgefordert werden. Die leidige und von Irrtümern durchsetzte Historie von Umwelt-Alarm macht das klar. Aber wird das auch in Schulen klar gesagt? Wir denken nicht.
Wir glauben, dass es dringend erforderlich ist, weiter zu evaluieren, was an unseren Schulen vor sich geht unter den Flaggen von „Nachhaltigkeit“ und im besonderen „Klimawandel“. Lehrerschaft und Rektoren an den Schulen stehen hier in der Verantwortung sicherzustellen, dass das Bildungsgesetz befolgt wird in Gestalt der Vermeidung jedweder Indoktrination in ihren Schulen, und Eltern haben ein offensichtliches Interesse herauszufinden, wie man mit ihren Kindern bei umstrittenen und hoch verstörenden Themen umgeht. Die stückweisen Informationen und Beispiele in diesem Report scheinen uns ausreichend zu belegen, dass Kinder Zielscheibe fanatischer Campaigner sind und dass sie mittels Ängstigung zu übereilten persönlichen und politischen Aktionen getrieben werden. Außerdem sind sie dem Risiko ausgesetzt, dass ihnen eine gründlichere, dem 21. Jahrhundert angemessene Bildung vorenthalten wird – Bildung, die es ihnen ermöglichen würde, alle Behauptungen zu hinterfragen und zu evaluieren, nicht nur diejenigen der Ängste erzeugenden Campaigner.
Es gibt eindeutig Anlass für schwere Bedenken. Nur eine systematische Evaluierung dessen, was vor sich geht, kann das Ausmaß der Indoktrination ans Tageslicht bringen, ebenso wie der emotionale und erzieherische Schaden, welcher den Schülern unzweifelhaft zugefügt wird. Wir appellieren daher an die Bildungsminister in England, Schottland, Wales und Nordirland dringend, die Bildung bzgl. Klimawandel an unseren Schulen unter die Lupe zu nehmen.
Das gesamte PDF steht hier.
Übersetzt von Chris Frey EIKE