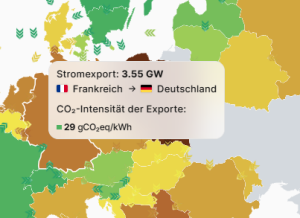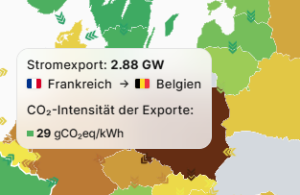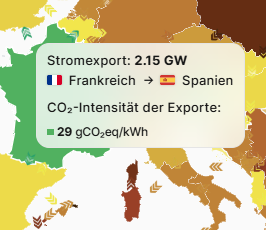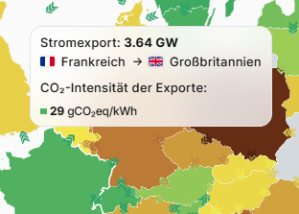Klimagate – ist ChatGPT auch nicht besser als Wikipedia oder ‚Spiegel‘?
Die beiden Klima-Gates 2009 und 2010, kurz vor der wichtigen Kopenhagener Konferenz COP 15, hätten der institutionalisierten Klimahysterie eigentlich medial das Genick brechen müssen – zu offensichtlich gaben zentrale Akteure intern zu, daß die wichtigsten Wekzeuge, die Computersimulationen, nicht funktionieren.
Aber die Profiteurs-Netzwerke waren hatten sich schon zu dicht um den Planeten gelegt. Hinzu kam außerdem, daß elitäre Milieus der westlichen Gesellschaft das Untergangs-Narrativ einschließlich des Leugner-Feindbildes dringend brauchen. Ergebnis: Die von elitären Akademikern betriebenen Zeitungen, TV-Sender und KI-Programme leugnen, beschönigen und verdrehen, was das Zeug hält – ganz im Sinne des billionenschweren Klima-Profteurskomplexes.
Der Watergate-Skandal (benannt nach einem Gebäudekomplex in Washington DC, dt. „Wassertor“), hat in den 1970ern Richard Nixon den politischen Kopf gekostet. In Anlehnung daran werden seit den 80er alle möglichen Korruptions-Skandale mit „-Gate“ bezeichnet.
Man staunt im Jahre 2025, wie klar der Klima-Manipulations-Skandal 2009 offen lag: Hacker hatten interne Mails der weltweit wichtigsten Klimaforscher im Server der Universität von East Anglia gefunden und veröffentlicht. Einige der elektronischen Briefe zeigten deutlich, daß sich die Klima-Simulierer darüber bewußt waren, daß ihre fast rein auf CO2 programmierten Programme nicht funktionierten. Aber ähnlich der geleakten Emails der Corona-Virologen um Christian Drosten und Anthony Fauci weigerten sich die Massenmedien, darüber zu berichten.
Oder, besser gesagt: Sie berichten sehr wohl – aber nur in angepaßter Form, ganz im Sinne der Klimaprofs. Auch wenn der Skandal 15 Jahre her ist, machen modernste Medien wie das KI-Programm ChatGPT da weiter, wo Spiegel und ARD früher aufhörten.
Unser Horst Lüdecke, der im Titelbild dargestellt sein soll (von ChatGPT :-)) fragte gerade ChatGPT nach Quellen für das Klimagate und erhielt nur PR-Antworten im Stile der Tagesschau:
Frage: Was war das Climate gate von 2009?
Antwort von ChatGPT: „Climategate“ bezeichnet eine Kontroverse, die im November 2009 kurz vor der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen entstand.
Frage: Ja, bitte!
Antwort von ChatGPT: Alles klar – hier die wichtigsten E-Mail-Stellen, die damals von Klimaskeptikern zitiert und fehlinterpretiert wurden, und was sie tatsächlich bedeuteten:
1. „Hide the decline“
Zitat (aus einer Mail von Phil Jones, CRU): Er sprach von einem „trick … to hide the decline“.
Vorwurf: Wissenschaftler würden absichtlich Temperaturabfälle verbergen.
Tatsächlich: Es ging um ein bekanntes Problem in der Dendroklimatologie (Baumring-Temperaturrekonstruktionen): Manche Baumdaten zeigten ab den 1960er-Jahren einen Abwärtstrend, der nicht den gemessenen Temperaturen entsprach.
Der „trick“ bedeutete einfach eine grafische Methode, die Baumdaten ab einem bestimmten Zeitpunkt durch echte Messdaten zu ersetzen, um die Darstellung korrekt zu machen.
Es war keine Manipulation, sondern ein transparenter, in Fachartikeln erklärter Schritt.
2. Diskussion über „peer review“
Zitat (sinngemäß): Einige Forscher diskutierten, wie man „schlechte Arbeiten“ vom Peer-Review fernhält.
Vorwurf: Unliebsame Meinungen würden unterdrückt.
Tatsächlich: Peer-Review ist eine Qualitätskontrolle. Die Mails zeigen, dass Wissenschaftler frustriert waren über methodisch schwache Studien, die dennoch in Fachzeitschriften erschienen.
Ihr Ton war unprofessionell, aber keine Absprache zur Unterdrückung valider Gegenmeinungen.
3. Selektive Datenauswahl
Zitat (sinngemäß): „Lasst uns bestimmte Daten nicht berücksichtigen …“
Vorwurf: Forscher würden unpassende Daten weglassen, um Trends zu schönen.
Tatsächlich: In der Klimaforschung ist es Standard, fehlerhafte oder unzuverlässige Datensätze kritisch zu prüfen und manchmal auszuschließen.
Die Untersuchungen bestätigten, dass es sich um legitime wissenschaftliche Praxis handelte, nicht um Betrug.
4. „Pressure on journals“
Zitat (sinngemäß): Klimaforscher beschwerten sich über eine Zeitschrift, die „junk science“ veröffentlichte.
Vorwurf: Sie würden Redakteure einschüchtern.
Tatsächlich: Wissenschaftler kritisierten das Review-Verfahren dieser Zeitschrift. Später traten tatsächlich Redakteure zurück, weil die Qualitätskontrolle dort mangelhaft war.
✅ Kurz gesagt:
Die Zitate wirkten in Blogs und Medien skandalös, weil sie aus dem Zusammenhang gerissen wurden. In den vollständigen Dokumenten und nach unabhängigen Prüfungen zeigte sich:
Es gab kein Belegen von Datenfälschung,
aber durchaus einen ungeschickten und manchmal arrogant wirkenden E-Mail-Ton.
Hier sind einige der bekanntesten deutschen Klimakritiker, die in der Diskussion um „Climategate“ aktiv waren, sowie verlässliche Quellen, die das belegen:
1. EIKE – Europäisches Institut für Klima und Energie
Der Blog Telepolis beschreibt, wie EIKE den „Climategate“-Skandal instrumentalisiert hat: man sah darin den „Einschlag einer Atombombe in das Gebäude der etablierten Klimaforschung“ Telepolis.
2. Horst-Joachim Lüdecke
Physiker, Publizist und Pressesprecher von EIKE. Er veröffentlichte 2009 ein Buch mit dem Titel CO₂ und Klimaschutz. Fakten, Irrtümer, Politik (ClimateGate) Wikipedia.
3. Fritz Vahrenholt
Chemiker, ehemaliger Umweltsenator und Mitbetreiber des skeptischen Blogs „Kalte Sonne“. Auch wenn eine direkte Verbindung zu „Climategate“ in den Quellen nicht klar hervorgehoben wird, zählt er zu den prominenten Skeptikern in Deutschland WikipediaEIKE.
4. Manuel Bonik & Andreas Schaale
Laut dem Telepolis-Bericht organisierten sie eine Veranstaltung zur „Klimalüge“ in Berlin, in deren Kontext auch „Climategate“ thematisiert wurde. Sie warfen Klimaforschern vor, mit „Manipulationen von Fakten“ zu arbeiten Telepolis.
5. Werner Kirstein
Emeritierter Geographie-Professor aus Leipzig, der auf einer Skeptiker-Konferenz eine polemische Rede hielt, in der er den Klimawandel als moderne „Ersatzreligion“ bezeichnete – eine indirekte Reaktion auf die aufgeheizte Debatte um „Climategate“ Süddeutsche.de.
Überblickstabelle
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. . .
Immerhin hat ChatGPT uns als schlimmste deutschsprachige Klimaskeptiker aufgeführt – sogar tabellarisch.
Ansonsten klingt der KI-Text wie aus der Feder von Correctiv oder SZ – ChatGPT gibt ja sogar SZ oder Andols Wikipedia allen Ernstes als Quelle an. Gerade Wiki dürfte nicht als Referenz genannt werden, da es nur eine Sammlung von Primärquellen ist. Selbst Schülern in der Mittelstufe wird von den Lehrern das Wiki-en verboten.
Will man nicht nur rosinengepickte 50%-Informationen über das Klimagate, kann man sich in alten EIKE-Artikeln darüber informieren, hier ein paar Beispiele:
Climategate 1: Menschgemachter Klimawandel und Lyssenkoismus
Climategate 4- Die Chronik eines wissenschaftlichen Skandals des IPCC Zulieferers CRU!