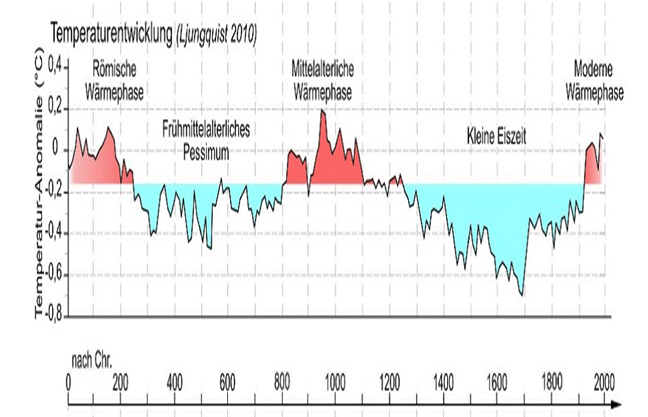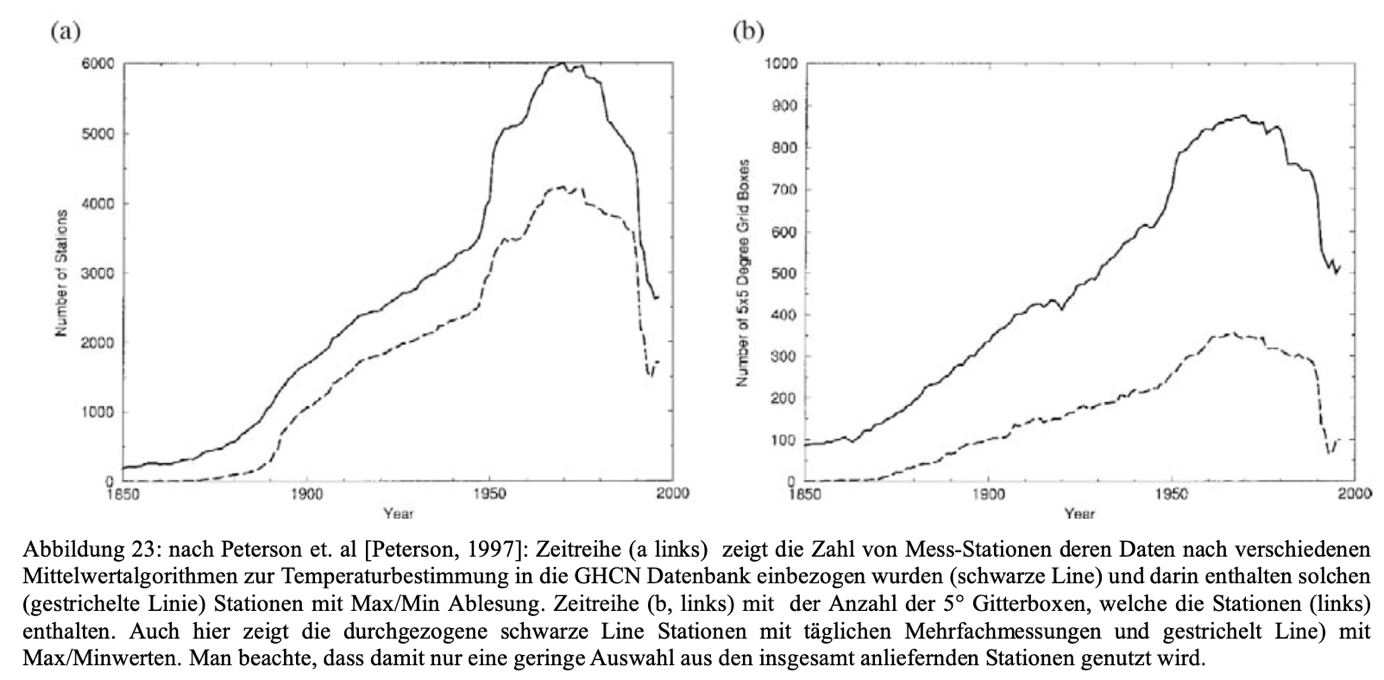Wasserstoff wird heute als Wundermittel der Energiewende gehandelt. Mit ihm sollen angeblich die Speicher-Probleme von Wind- und Sonnenenergie gelöst werden. Dritter und letzter Teil einer Mythenkillerfolge über den „Hochlauf der grünen Wasserstoffwirtschaft“ in Deutschland.
von Manfred Haferburg
Dies ist der dritte Teil einer kleinen Artikelserie über den „Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft“ in Deutschland. Grüner Wasserstoff ist ein Energiewendeprojekt, dessen staatliche Zeit- und Umfangsvorhaben geprägt sind von Größenwahn, Allmachbarkeitsphantasien und physikalisch-ökonomischem Dilettantismus. Nicht mal die Staatliche Plankommission der DDR hätte es gewagt, mit derartigem Unfug in die Öffentlichkeit zu gehen.
Der Autor will gar nicht behaupten, dass Wasserstoff in der Zukunft keine Rolle in der Wirtschaft spielen wird. Doch der grüne Aktionismus der Ampelregierung spricht so offensichtlich jeder Vernunft Hohn, dass man ernsthafte Zweifel am Geisteszustand der beteiligten Protagonisten bekommt.
Woher den Wasserstoff nehmen und nicht stehlen
Heute lese ich, dass die nigerianische Armee versehentlich 85 Zivilisten getötet hat. Es handele sich um Dorfbewohner, die ein muslimisches Fest feierten, unter ihnen viele Frauen und Kinder.
Was hat das mit Wasserstoffwirtschaft zu tun, werden Sie, verehrter Leser, berechtigt fragen? Nun, dann erinnern wir uns mal kurz an eine Meldung vom 30.10.2023: „Bundeskanzler Olaf Scholz sieht Nigeria als möglichen Lieferanten von Wasserstoff und auch Flüssiggas für Deutschland.“ Im Zuge der Energiewende benötige die Bundesrepublik insbesondere Wasserstoff-Importe, dabei komme Nigeria ins Spiel.„Nigeria hat einen ehrgeizigen Plan für die Energiewende“, sagte Scholz auf einem Wirtschaftsforum in Lagos. Das Land sei „auch gut aufgestellt, um ein zentraler Akteur für Erneuerbare Energie und Wasserstoff zu bleiben – ebenso wie für Flüssigerdgas, das wir in den kommenden Jahren weiterhin brauchen werden, bis der Wasserstoffmarkt voll etabliert ist“. Nigeria bekommt vom deutschen Steuerzahler nächstes Jahr 640 Millionen Euro für „Klimaprojekte“. Noch Fragen?
Derzeit gibt es noch keine nennenswerte industrielle Produktion von „grünem Wasserstoff“. Die Bundesregierung erwartet bis 2030 einen Wasserstoffbedarf von 90 bis 110 Terawattstunden. Die in Deutschland erzeugte Menge an Erneuerbaren Energien wird aber bei Weitem nicht ausreichen, um den benötigten Wasserstoff klimaneutral herzustellen, das zeigt sogar die Nationale Wasserstoffstrategie. Um den zukünftigen Bedarf zu decken, will die Bundesregierung daher auf Wasserstoffimporte und internationale Kooperationen setzen. Das Problem: Auch mit Importen kann die Versorgungslücke voraussichtlich nicht geschlossen werden.
Für die Kosten der erforderlichen Anlagen zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien und zur grünen Wasserstofferzeugung kommen bis 2030 etwa 500 Milliarden Euro auf die Deutschen zu.
Das Wasserstoff-Mengenproblem
In Leipzig wurde vor wenigen Wochen die erste Wasserstoffready-Gasturbine mit einer Leistung von 123 MW in Betrieb genommen – das ist etwa ein Zehntel der Leistung eines Kernkraftwerkes. Nicht einmal dafür gibt es Wasserstoff – sie läuft mit schnödem Erdgas. Irgendwann in ein paar Jahren soll auf H2 umgestellt werden. Nach den offiziellen Planungen der Bundesregierung zum Ausbau der Wasserstoffready-Gaskraftwerkskapazität auf 21 GW müssten bis 2030 etwa 160 Gaskraftwerke dieses Typs gebaut werden. Oder eben 70 mit größerer Leistung von ca. 300 MW. Die 100.000-Dollar-Frage ist: Wo soll der ganze grüne Wasserstoff dafür herkommen?
Die Bundesregierung strebt in der Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie bis 2030 eine Elektrolyse-Leistung von 10 Gigawatt (GW) grünen Wasserstoffs in Deutschland an. Damit gemeint ist die installierte Leistung. Das heißt, die Leistung, die theoretisch unter Volllast genutzt werden kann. Diese ist bei Wind und Sonne aber praktisch nicht nutzbar, sondern weniger als 20 Prozent. Die deutsche Elektrolyse-Kapazität liegt im Jahr 2022 übrigens laut Statista bei knapp 0,057 GW oder 57 Megawatt.
Der Autor hat seine eigene Rechnung aufgemacht, die darauf fußt, dass es das erklärte Ziel der Bundesregierung ist, bis 2045 das gesamte Land zu dekarbonisieren. Koste es, was es wolle. Dabei muss man vom Primärenergieverbrauch ausgehen statt vom Stromverbrauch. Denn der Strom stellt nur ein Viertel des Primärenergieverbrauchs dar.
Die folgende Rechnung ist eine Überschlagsrechnung und erhebt keinen Anspruch auf Genauigkeit. Die ist auch nicht möglich, da die zur Verfügung stehenden Zahlen meist Schätzungen oder Hochrechnungen sind. Eine Steigerung des Energiebedarfs in der Zukunft ist beispielsweise nicht berücksichtigt. Die Überschlagsrechnung dient nur der Versinnbildlichung der für den Laien sonst schwer vorstellbaren Größenverhältnisse.
Eine Industriebrache, flächendeckend mit Windrädern und Solarpaneelen zugepflastert
Strom macht nur ein Viertel des gesamten Primärenergieverbrauchs von etwa 12.000 Petajoule aus. 12.000 Petajoule sind etwa 3.300.000 Gigawattstunden Primärenergieverbrauch pro Jahr. Davon stemmen die „Erneuerbaren derzeit gerade mal ca. 17 Prozent, also etwa 560.000 GWh/a in Form von Flatter-Strom. Bleiben 2.740.000 GWh/a Primärenergie, die bei vollständiger Dekarbonisierung – also die Umstellung von Wohnen, Industrie und Verkehr – irgendwie durch Wasserstoff ersetzt werden müssen.
Aus einem Kilogramm Wasserstoff kann man etwa 30 Kilowattstunden Strom erzeugen, also braucht man 30 Tonnen H2 für 1 GWh. Um den gesamten verbleibenden Primärenergieverbrauch von 2.740.000 GWh, der heute noch von konventionellen Energieträgern bereitgestellt wird, zu elektrifizieren, benötigt man ca. 82 Millionen Tonnen Wasserstoff. Das ist eine unvorstellbare Menge.
Um diesen Wasserstoff mit „erneuerbarer Energie“ in Elektrolyseuren herzustellen, würde man die mehrfache Fläche Deutschlands zum Aufstellen von Windrädern und Solarpaneelen benötigen. Jeder mag sich selbst vorstellen, wie ein Land aussieht, das komplett flächendeckend mit Windrädern und Solarpaneelen in eine Industriebrache umgewandelt wird und welche Auswirkungen diese Installationen auf die Natur hätten. Es ist auch mehr als fraglich, ob andere Länder ihre Landschaften derartig verschandeln würden, um für die deutsche Energiewende grünen Wasserstoff zu produzieren. Von den Kosten gar nicht zu reden.
Das Wasser- und Abgasproblem
Um ein Kilogramm grünen Wasserstoff in einem Elektrolyseur zu erzeugen, werden schätzungsweise 20 Liter aufwendig aufbereitetes Reinstwasser benötigt. Für die 8,2 Mio. Tonnen H2 werden also 164 Mio. Tonnen hochreines Wasser benötigt. Diese Wasserentnahme aus der Umwelt der Elektrolyseure, aber auch deren Abwässer stellen ein Umwelt-Problem dar, das der Lösung bedarf.
Viele Menschen glauben den Schönfärbern, dass aus einer Wasserstoff-Gasturbine am Ende nur etwas Wasser und warme Luft austritt. Leider stimmt das nicht. Das Abgas einer Wasserstoff-Gasturbine enthält jede Menge Stickoxide NOx, und auch das Abwasser kann nicht einfach so in den nächsten Bach abgelassen werden. Genaues weiß man noch nicht, an diesem Thema wird gegenwärtig noch geforscht.
Das Wasserstoff-Importproblem
Deutschland ist schlichtweg flächenmäßig zu klein und verfügt nicht über äquatoriale klimatische Bedingungen, um genug grünen Wasserstoff herstellen zu können. Mit der installierten Leistung von 10 Gigawatt kann der Bedarf, den die Bundesregierung für 2030 annimmt, die Menge der Energie aus Wasserstoff, laut fortgeschriebener Wasserstoffstrategie in Höhe von 95 bis 130 TWh, nicht erfüllt werden. Daher soll zusätzlich eine gigantische Wasserstoff-Importstrategie installiert werden.
Wie hoch die Importquote sein wird, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab und lässt sich im Jahr 2023 nicht sicher beantworten. Szenarien zeigen, dass mehrere 100 TWh pro Jahr zu Kosten von bis zu 15 Mrd. Euro an Erneuerbaren Energien in Form von grünem Wasserstoff importiert werden müssen.
Klima-Kanzler, Klima-Vizekanzler, Klima-Außenministerin, Umweltministerin und andere klimabewegte Ampel-Häuptlinge reisen mit großen Worten und noch größeren Geldkoffern durch die Welt, um Norweger, Australier und vor allem Afrikaner davon zu überzeugen, dass sie den Wasserstoff, den die Vorreiter so nötig brauchen, in ihren Ländern für die Deutschen produzieren müssen. „Schätzungsweise werde 2030 eine zweistellige Zahl von Ländern grünen Wasserstoff nach Deutschland exportieren“, so das Wirtschaftsministerium. Diese Vielfalt sei wichtig, um künftige Abhängigkeiten zu vermeiden. BlackRock reibt sich schon die Hände – die haben umfangreich in Wasserstoffaktien investiert.
Vizekanzler Habeck erläuterte auf einem seiner Wasserstoff-Trips eine seiner Wasserstoff-Importvisionen: „Namibia hat, gemessen auch an europäischen Standorten, natürlich sehr, sehr große Standortvorteile – sehr sonnenreich, sehr starke Windgebiete, gerade am Atlantik“. Da hat Robert Habeck natürlich recht, in der Wüste gibt es viel Sonne, die man zur Wasserstoffproduktion nutzen könnte. Aber wie es bei Visionen so ist, es gibt oft kleine, für den Visionär fast unsichtbare Realitäts-Problemchen. Da stellen wir uns mal ganz dumm und denken die Praxis der Vision durch.
Alles, alles muss erst gebaut werden
Es fängt schon blöd an: In der Wüste gibt es leider kein Wasser, denn sonst wäre es ja keine Wüste. Aber die Elektrolyseure machen den Wasserstoff aus Wasser, viel Wasser. Also müssen erst mal Wasserentsalzungsanlagen ans Meer gebaut werden. Die brauchen aber Strom, den es in der Wüste auch nicht gibt. Also muss ein Solarkraftwerk für die Wasseraufbereitungsanlagen gebaut werden. Auch ein paar Stromkabel und Puffer-Stromspeicher werden gebraucht. Dann braucht man noch ein paar Wasserleitungen zu den Elektrolyseuren, die auch noch gebaut werden müssen. Um die Elektrolyseure anzutreiben, braucht man mehr Solar- und Windkraftanlagen, sonst wird es kein grüner Wasserstoff. Dann benötigt man noch ein Wasserstoff-Speicherlager mit Verdichteranlagen für die 700 bar, Kühlanlagen zur Verflüssigung bei minus 250 Grad und dann Rohrleitungen zu einem Hafen, wo die Wasserstofftankschiffe festmachen und laden können.
Auch die Speicher und Verarbeitungsanlagen und den Hafen gibt es nicht, alles muss gebaut werden. Die Wasserstoff-Transportschiffe, die in ihren Tanks den Wasserstoff weiter bei minus 250 Grad halten, gibt es auch nicht. Bisher gibt es nur ein japanisches Wasserstoff-Versuchstankschiff „Suiso Frontier“ mit 1.250 Kubikmeter Transportvolumen, das aber leider noch mit Schweröl angetrieben wird. Also gilt es, eine Wasserstoff-Tankerflotte für die 82 Millionen Tonnen Wasserstoff zu bauen, die natürlich auch mit Wasserstoff angetrieben wird. Dann braucht man noch Wasserstoffterminals zum Anlanden in Deutschland, Wiedervergasungsanlagen, 10.000 Kilometer Wasserstoff-Transportautobahnen und die vielen Gaskraftwerke. Was unter diesen Bedingungen wohl eine Tonne Wasserstoff oder eine Kilowattstunde grüner Strom kosten wird?
Die deutsche Regierung hat sich offenbar vorgenommen, eine ganze Industrie nach Afrika und ein dazugehöriges weltumspannendes Transportsystem nach Deutschland zu bauen. Was das kostet? Weiß keiner, egal, ist ja nur Geld. Sicher kommt bald das „Gute grüne Wasserstoff-Hochlauf-Wummsgesetz im Deutschlandtempo“. Dann muss die Ampel nur noch die Ärmel hochkrempeln und am Verfassungsgericht vorbei ein Wasserstoff-Hochlauf-Sondervermögen in Höhe von ein paar Phantastilliarden aufgleisen, damit diese nachhaltige Zukunftsvision auch von den nächsten 10 Generationen finanziert werden kann. Irgendein Notstand wird sich doch wohl finden lassen?
Teil 1 finden Sie hier.
Teil 2 finden Sie hier.