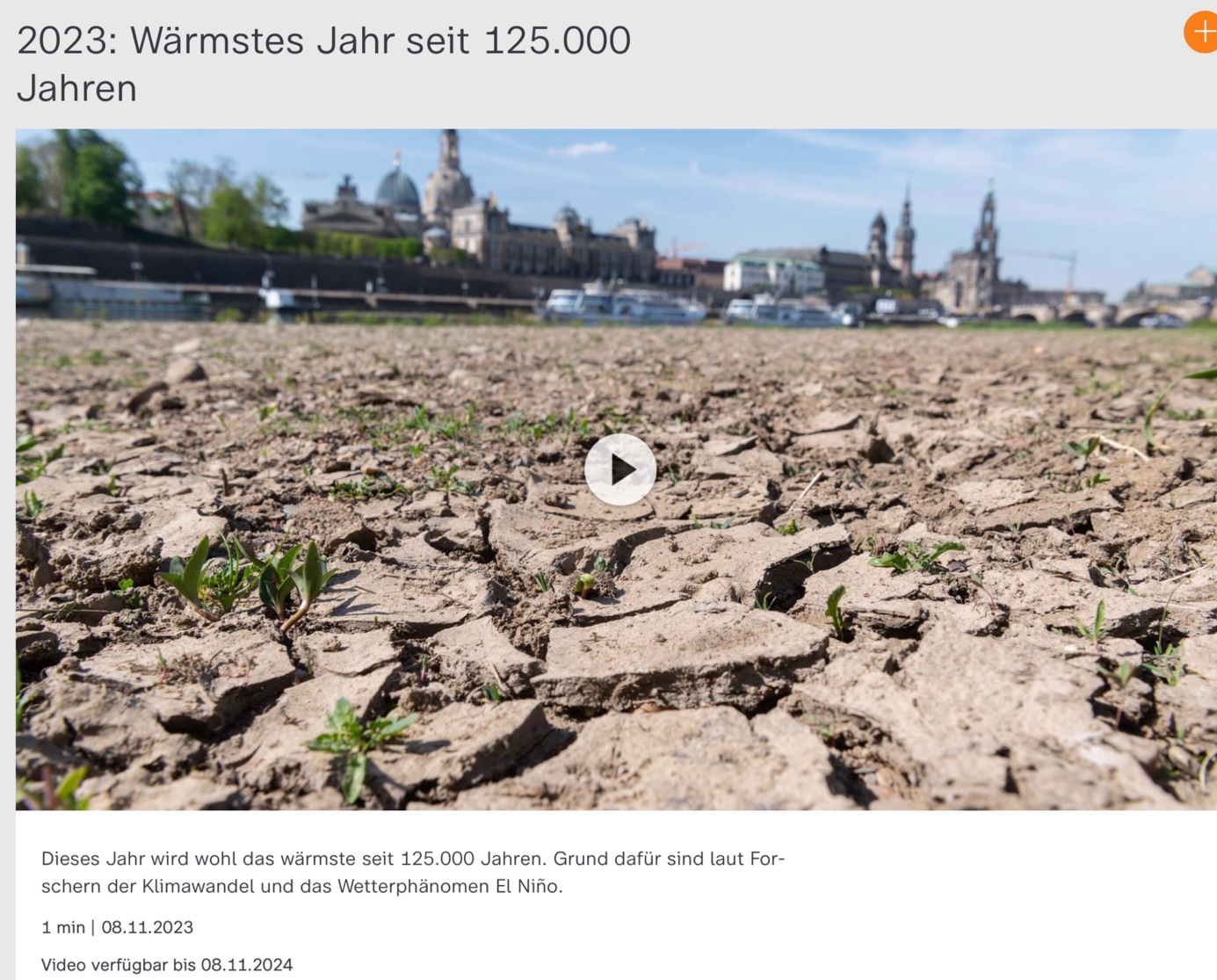Die Befürworter des Brückenstrompreises verfolgen eine zynische Politik. Mit gigantischen Subventionen wollen sie die Folgen der ökologischen Klimapolitik möglichst lange verschleiern.
Von Alexander Horn
Mit der vorangeschrittenen Überwindung der Folgen der Corona-Krise und des Kriegs in der Ukraine lichtet sich der Nebel über der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Zwar werden noch immer viele Nebelkerzen geworfen, die Ursachen der nicht enden wollenden wirtschaftlichen Malaise werden jedoch immer deutlicher. Es zeigt sich nun, dass die deutsche Wirtschaft und insbesondere die Industrie nicht etwa wegen Lieferkettenproblemen und Energiemangel – die inzwischen weitgehend überwunden sind –, sondern dessen ungeachtet in einer tiefen wirtschaftlichen Krise stecken.
Auslöser für diese Talfahrt ist die in Deutschland längst in Gang gekommene Deindustrialisierung, die von steigenden Energiepreisen, vor allem von den seit Jahrzehnten rasant steigenden Strompreisen, ausgeht. Entgegen der gebetsmühlenartigen Behauptung, die Deindustrialisierung beginne erst jetzt, drohe nur oder sei nicht zu erwarten, sind die Schleifspuren der ökologischen Klimapolitik schon seit Anfang der 2000er Jahre erkennbar. Denn diese Klimapolitik will ohne jede Rücksicht auf den gesellschaftlichen Wohlstand eine sogenannte Klimaneutralität erreichen, indem sie massive und extrem teure Senkungen des Energieverbrauchs durchzusetzen versucht. Gleichzeitig zielt sie darauf ab, den verbleibenden Bedarf ausschließlich mit den nur begrenzt verfügbaren und zudem teuren erneuerbaren Energien zu decken, hierzulande vor allem mit Wind- und Sonnenenergie.
Seit dem konjunkturellen Aufschwung vor der Finanzkrise 2008 sinkt die Produktion der energieintensiven Industriebranchen, darunter der Stahl-, Chemie- und Papierindustrie, die eine Million relativ gut bezahlter Industriearbeitsplätze und ein Fünftel der industriellen Wertschöpfung in Deutschland in die Waagschale werfen. Bis zum Beginn des Ukraine-Kriegs war deren Produktion, begleitet von der Desinvestition dieser Branchen, bereits um zehn Prozent geschrumpft. Seitdem ist die Wertschöpfung um weitere knapp 20 Prozent eingebrochen. Die energieintensiven Unternehmen haben die Produktion zurückgefahren oder stillgelegt, und sind, wo dies aufgrund vorhandener Kapazitäten möglich war, auf andere Standorte im Ausland ausgewichen. Somit liegt das derzeitige Produktionsniveau etwa 30 Prozent niedriger als noch vor der Finanzkrise 2008 und es sinkt derzeit weiter, wie das Statistische Bundesamt ausweist.
Ausgehend von der Deindustrialisierung in den energieintensiven Branchen ist die Produktion der gesamten Industrie seit 2018 zurückgegangen, also schon deutlich vor dem Beginn der Corona-Krise. Die Schrumpfung der energieintensiven Branchen ist so ausgeprägt, dass die anderen Industriebranchen deren Produktionsschrumpfung seit 2008 nicht mehr ausgleichen können. So liegt die heutige industrielle Wertschöpfung in Deutschland etwa fünf Prozent unter dem Niveau von 2008.
Grüne Herzen schlagen für die Industrie
Wie schlecht es um die Industrie steht, lässt sich daran ablesen, dass ausgerechnet diejenigen, die bisher den energiepolitischen Kurs zum kompletten Ausstieg aus fossilen und konventionellen Energien am vehementesten durchsetzen und dadurch für explodierende Strompreise sorgen, nun ihr Herz für die energieintensiven CO2-Emittenten entdecken. So findet die Bundesvorsitzende der Grünen Ricarda Lang inzwischen, es sei „wichtig, energieintensive Unternehmen zu entlasten“. Bundeswirtschafts- und -klimaminister Robert Habeck (Grüne) kämpft für massive Subventionen, um energieintensiven Betrieben durch die Einführung eines verbilligten Industriestrompreises die Existenz zu sichern.
In der von ihm in der vergangenen Woche vorgestellten industriepolitischen Strategie wird der „Brückenstrompreis“ sogar als „das entscheidende Instrument“ zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit dargestellt. Mit dem Brückenstrompreis hatte Habeck bereits im Mai auf Forderungen aus der Industrie reagiert und eine Subvention für energieintensive Unternehmen ins Spiel gebracht. Diese soll vorläufig auf die 2020er Jahre befristet sein und insgesamt etwa 30 Milliarden Euro kosten. Energieintensive Unternehmen könnten dann von einem subventionierten Strompreis von sechs Cent pro Kilowattstunde profitieren. Komme dieser Strompreis nicht, „drohen Produktionsrückgänge oder sogar die Abwanderung strukturell wettbewerbsfähiger Unternehmen aus Deutschland“, so Habecks industriepolitische Strategie.
Grünes Eldorado?
Bei der Vorlage des Arbeitspapiers zum Brückenstrompreis begründete Habeck dieses Instrument damit, dass die Industrie erst langfristig „von günstigem Strom aus Erneuerbaren Energien profitieren“ werde. Dazu müsse „der massive Ausbau von Erneuerbaren Energien […] mit klugen Instrumenten für den direkten Zugang der Industrie zu billigem grünem Strom gekoppelt“ werden. Bis diese „Langfristmaßnahmen greifen“, könne man jedoch nicht warten, so Habeck weiter, sondern brauche „eine Brücke […], die dann in eine Zukunft mit niedrigen erneuerbaren Strompreisen und ohne Subventionen führt.“
Dieses von Habeck gebetsmühlenartig wiederholte Narrativ eines nur vorübergehend erforderlichen Brückenstrompreises wird auch von den Kritikern seines Konzepts nicht in Frage gestellt. So teilt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der dem Brückenstrompreis ablehnend gegenübersteht, das Narrativ eines auf lange Sicht grünen Eldorados mit billiger erneuerbarer Energie. Dieser irrigen Vorstellung folgend hat Scholz in diesem Sommer auf einer Veranstaltung des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI) erklärt, dass er die Energiewende „vom Ende her“ denke und das „Ziel, […] ein Industriestrompreis von vier Cent“ als Ergebnis der sozial-ökologischen Transformation stehe.
Ein Strompreis von 4 Cent/kWh, wie vom Bundeskanzler versprochen, ist wahrlich eine großartige Aussicht. Denn in Deutschland lagen die Strompreise für Privathaushalte, die anders als große Teile der Unternehmen nicht von vergünstigten Tarifen profitieren, bereits vor dem Beginn des Kriegs in der Ukraine im Jahr 2021 bei durchschnittlich 32 Cent/kWh.
Verantwortlich für die hohen Preise ist der steigende Anteil des eingespeisten hochsubventionierten Wind- und Solarstroms. Von fast null zur Jahrtausendwende ist der Anteil von Wind- und Solarstrom am Bruttostromverbrauch in Deutschland auf inzwischen knapp ein Drittel angestiegen. Dadurch sind die Strompreise für Privathaushalte von damals 14 Cent/kWh auf durchschnittlich etwa 32 Cent/kWh im Jahr 2021 gestiegen. Wohin diese Reise führt, zeigt sich noch deutlicher in Dänemark, wo die Stromkunden sogar noch mehr als in Deutschland zahlen. Dort basiert die Stromerzeugung zu einem höheren Anteil auf Wind- und Solarenergie, weswegen die Privathaushalte 2021 bereits 37 Cent/kWh berappen mussten.
Strom immer teurer
Die mit zunehmendem Anteil der Erneuerbaren steigenden Strompreise sind jedoch nur ein Vorgeschmack auf die anstehende Strompreisexplosion der nächsten Jahrzehnte. Denn mit einem steigenden Anteil der volatilen Erneuerbaren und dem vorgesehenen vollständigen Ersatz der grundlastfähigen und flexiblen konventionellen Stromquellen wie Kohle, Atomkraft und Erdgas müssen erneuerbare Energien so transformiert werden, dass sie auch während Dunkelflauten bedarfsgerecht Strom liefern.
Eine Möglichkeit, um dies zu bewerkstelligen, besteht darin, den Wind- und Solarstrom mittels Elektrolyse in Wasserstoff umzuwandeln, diesen zu speichern, um ihn dann bedarfsgerecht in Wasserstoffturbinen zur Stromerzeugung zu nutzen. Aufgrund physikalischer Wirkungsgrade gehen bei dieser Transformation etwa drei Viertel der ursprünglich erzeugten Wind- und Solarenergie verloren. Dadurch wird ein Vielfaches an erneuerbarer Energie benötigt, was sich entsprechend im Preis niederschlägt. Zusätzlich wird das Preisniveau dadurch nach oben getrieben, dass gigantische Kapazitäten zur Elektrolyse, Wasserstoffspeicherung und Wasserstoffverbrennung aufgebaut und betrieben werden müssen, um die erforderliche Energietransformation zu ermöglichen.
Da sich diese energiepolitischen Realitäten erst in vielen Jahren oder sogar erst in Jahrzehnten auswirken werden, nämlich erst dann, wenn die Erneuerbaren bedarfsgerechten Strom liefern müssen, lässt sich diese Problematik bislang getrost beiseiteschieben und die Illusion sogar sinkender Strompreise aufrechterhalten.
So findet der von Habeck ins Spiel gebrachte Brückenstrompreis viele Fürsprecher, zum Beispiel in der energieintensiven Wirtschaft, deren Unternehmens- und Gewerkschaftsvertreter nach Subventionen lechzen und mit Recht fürchten, dass sie früher oder später ohnehin ihre Betriebe schließen müssen. Ausgerechnet Unternehmen, denen unter den Prämissen der ökologischen Klimapolitik die Stromkosten davonlaufen, sind zu den größten Anhängern dieser Klimapolitik mutiert. Sie sehen in staatlichen Subventionen und zunehmendem EU-Protektionismus eine Chance, einerseits die Kosten senken und andererseits die Preise hoch halten zu können. Sie spekulieren auf staatliche Subventionen in großem Stil, da insbesondere die Politik den von den energieintensiven Industrien ausgehenden drohenden Kollaps der Industrie in Deutschland verhindern und stattdessen eine schleichende Deindustrialisierung ermöglichen will.
Schrecken ohne Ende
Langfristig am stärksten betroffen sind jedoch diejenigen energieintensiven Unternehmen, die einen hohen Anteil fossiler Energie- und Rohstoffe einsetzen und auf Dauer auf klimaneutral erzeugten Wasserstoff oder Strom umstellen müssen. Noch immer beziehen sie, im Vergleich zu den hohen Strompreisen, vergleichsweise sehr billige fossile Rohstoffe, die jedoch in den nächsten Jahren zunehmend der CO2-Bepreisung unterworfen werden. Langfristig können sie nur überleben, wenn der Staat nicht nur Milliardensubventionen für die technologische Umstellung – etwa für grünen Stahl – leistet, sondern die hohen Kosten für klimaneutralen Strom und Wasserstoff dauerhaft heruntersubventioniert.
In diesen Unternehmen sehen Eigentümer- wie auch Arbeitnehmerseite zeitnah fließende Dauersubventionen als einzige Chance, um einen Teil des investierten Kapitals sowie der Jobs zumindest über einen gewissen Zeitraum zu retten. So kann die langfristige Abwicklung dieser Industrien sowohl für die Kapital- wie auch für die Arbeitnehmerseite profitabilitätssichernd bzw. sozialverträglich erfolgen. Die Industrie verschwindet nicht mit einem großen Knall, sondern durch eine Fortführung der bisherigen Desinvestitionsstrategie, die eine schleichende Deindustrialisierung bewirkt.
Brücke in die Deindustrialisierung
Die vielen hundert Milliarden Subventionen, die Habeck seiner industriepolitischen Vorstellungen zufolge unter anderem als „Brückenstrompreis“ in die Industrie pumpen will, dienen nicht dazu, die Industrie zu retten und die „Wettbewerbsfähigkeit“ der Unternehmen zu erhalten. Wie bereits einige Ökonomen erklärt haben, sind die energieintensiven Industrien unter den Prämissen der ökologischen Klimapolitik nicht zu retten. Das hat diese Kritiker jedoch in aller Regel nicht dazu bewegt, öffentlich an dieser Klimapolitik zu zweifeln. Man sollte, wie der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Moritz Schularick, kürzlich ausgeführt hat, „das Geld nicht in die energieintensive Industrie stecken, sie wird auf Dauer ohnehin verschwinden“. Also frei nach dem Motto: Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende.
Die Kritiker sehen vielmehr das Problem, dass die Subventionen nur vergleichsweise wenigen Betroffenen zukommen. Die große Masse der verbleibenden Unternehmen würde jedoch zusätzlich geschädigt, weil sie letztlich für diese Subventionen aufkommen müssen, entweder unmittelbar über noch höhere Energiepreise oder indirekt durch die Finanzierung steigender Staatsschulden.
Dieser Sichtweise folgend hat sich Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) inzwischen zwar gegenüber der von den Verbänden geforderten Verlängerung des Spitzenausgleichs, einer bisher gewährte Subvention von etwa 1,7 Milliarden Euro jährlich für derzeit etwa 6.000 energieintensive Betriebe, kompromissbereit gezeigt. Den Brückenstrompreis lehnt er hingegen ab, denn er sei „nicht davon überzeugt, für einige wenige Konzerne den Strompreis auf Kosten von allen Steuerzahlern zu subventionieren“. Lindners Kalkül besteht offenbar darin, die Unternehmen, die trotz dauerhaft steigender Energiepreise zumindest eine Chance auf Weiterbestand haben, vor zusätzlichen Belastungen zu bewahren.
Habeck und andere Befürworter des „Brückenstrompreises“ wiederum fürchten, dass ein regelrechter Kollaps der energieintensiven Industrie den in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien etablierten Konsens über die ökologische Klimapolitik ins Wanken bringen könnte, da die Bürger aufbegehren. Ihnen geht es nicht darum, die Industrie und die Jobs zu retten, sondern einzig um die Rettung ihrer Klimapolitik vor den Bürgern. Um dies zu erreichen, müssen sie die Folgen der ökologischen Klimapolitik möglichst lange verschleiern.
Die von Habeck aufgegriffene Idee einer Brücke ist ein genialer Slogan, denn so gelingt es unwidersprochen, eine ferne, bessere Zukunft in Aussicht zu stellen und mit Hilfe gigantischer Subventionen die Zustimmung der hauptsächlich betroffenen Unternehmen und ihrer Beschäftigten zu dieser Politik zu erkaufen. Der „Brückenstrompreis“ zur vermeintlichen Rettung der Industrie ist ein zynisches Vorhaben, denn er bildet nichts anderes als eine Brücke in die schleichende Deindustrialisierung.
Mehr von Alexander Horn lesen Sie in seinem aktuellen Buch „Die Zombiewirtschaft – Warum die Politik Innovation behindert und die Unternehmen in Deutschland zu Wohlstandsbremsen geworden sind“ mit Beiträgen von Michael von Prollius und Phil Mullan.
Der Beitrag erschien zuerst bei TE hier