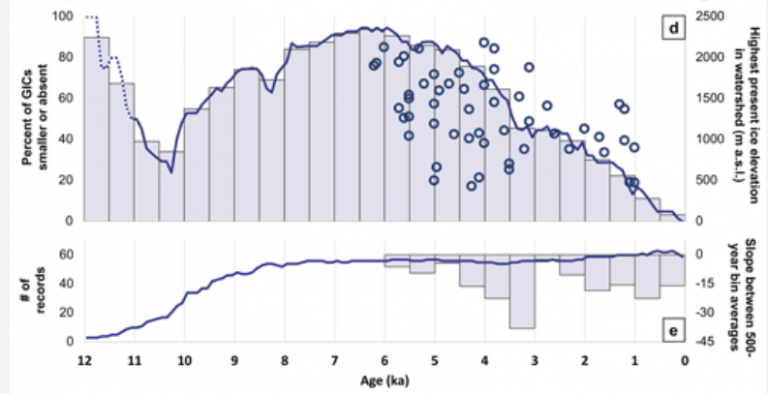ITER: Kernfusion oder Konfusion?
von Hans Hofmann-Reinecke
Es ist bemerkenswert, dass die kontrollierte Kernfusion in den phantasievollen Szenarien zur Sicherung der deutschen Energieversorgung selten ins Spiel kommt. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass sich im teuersten Projekt zu dem Thema, namens ITER, die Termine laufend in die Zukunft und die Kosten in die Höhe bewegen. Und vielleicht wird uns ITER eines Tages vor Augen führen, dass die vergessenen Grenzen des Möglichen auch mit beliebig viel Geld nicht zu überwinden sind.
150 Millionen Grad Celsius
Der Zweck des International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) ist es, den „Proof of Concept“ zu liefern, dass kontrollierte Kernfusion zur Gewinnung von Elektrizität eingesetzt werden kann.
In der Kernfusion werden leichte Atomkerne, etwa die Kerne von Wasserstoff, einander ganz nahe gebracht. Dann kann die anziehende „starke Wechselwirkung“ die elektrische Abstoßung überwinden und die Kerne verschmelzen. Damit es soweit kommt müssen die Kerne sehr vehement aufeinander prallen, dann klappt es vielleicht.
In jedem Gas prallen Atome permanent auf einander, und zwar umso heftiger, je heißer das Gas ist. Heizen wir also auf, so weit es geht, und warten, war passiert. Bei etwa 10.000 Grad Celsius sind die Kollisionen so stark, dass die Elektronen von den Atomen abstreift werden – wir bekommen ein atomares Striptease. Das Ergebnis ist eine sehr heiße Suppe aus nackten Atomkernen und freien Elektronen. Diese Suppe wird „Plasma“ genannt.
Jetzt müssen wir unsere freien Atomkerne nur noch dazu bringen, dass sie ihre gegenseitige elektrische Abstoßung überwinden und verschmelzen. Dazu muss die Temperatur noch einmal um mehr als den Faktor 10.000 erhöht werden, auf etwa 150 Millionen Grad.
Helium, benannt nach dem Sonnengott
Wir machen uns das Leben leichter, wenn wir nicht mit alltäglichem Wasserstoff arbeiten, dessen Atomkern aus einem Proton (p) besteht, sondern mit Deuterium (D) und Tritium (T). Die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit zu verschmelzen als zwei Protonen. Deuterium (D) und Tritium (T) tragen im Gegensatz zur landläufigen Sorte des Wasserstoffs noch ein bzw. zwei Neutronen (n) in ihrem Kern herum.
Der Kern von D ist also 1p1n und T ist 1p2n. Wenn dann tatsächlich eine Fusion stattfindet, dann sieht das so aus: 1p1n + 1p2n → 2p2n + 1n + Energie
Das Fusionsprodukt 2p2n ist der Atomkern des Gases Helium, das wir auch auf der Sonne finden, und n ist ein einzelnes Neutron, welches mit mörderischer Geschwindigkeit davonfliegt und den Löwenanteil der Energie E mit sich nimmt, der bei der Fusion frei wurde. Diese Energie können wir nutzen, um nach einigen Zwischenschritten elektrischen Strom zu erzeugen.
Also her mit den 150 Millionen Grad und los geht’s.
Leider gibt es da aber ein Problem. Während wir ein Stück Metall auf den Tisch legen, Flüssigkeit in eine Schale gießen und Gas in eine Flasche pumpen können, müssen wir beim Plasma darauf achten, dass es nicht die Wandung seines Behälters berührt. Entweder würde es sich bei der Gelegenheit abkühlen oder der Behälter würde verdampfen – auf jeden Fall wäre das Plasma verloren.
Und wie funktioniert das auf der Sonne? Die besteht doch fast nur aus Plasma? Die Sonne hält das Plasma durch die eigene gigantische Schwerkraft zusammen. Wie sollen wir auf der Erde machen?
Da gibt es nun einen Trick: Magnetismus. Die Atomkerne und Elektronen aus denen das Plasma besteht sind ja elektrisch geladen und sie bewegen sich sehr schnell. Elektrische Teilchen werden in magnetischen Feldern von ihrer Flugbahn abgelenkt, und zwar immer quer zur momentanen Bewegung und quer zu den Magnetlinien. Sie bewegen sich also im Kreis oder auf einer Spirale um die Magnetlinien. Atome und Elektronen können daher nur parallel zu den Magnetlinien ungestört geradeaus fliegen. Man nehme also ein Rohr, lege es längs in ein Magnetfeld, und jetzt kann das Plasma nur mühsam an die Wände des Rohres driften, während es sich in Längsrichtung frei bewegen kann.
Wenn das Plasma allerdings an die Stirnflächen des Rohres stößt, dann hat die Magie ihr Ende.
Ein teurer Donut
Kluge Forscher aus Russland haben nun so ein Rohr zu einem Ring gebogen und die offenen Enden zusammengeschweißt. Das sah dann so aus wie eine „Donut“, in dessen Inneren statt Marmelade ein Magnetfeld zu finden ist. Sie gaben dem Gebilde den Namen Tokamak, wobei die Silbe To für „Torus“ steht, dem lateinischen Wort für Donut.
In solch einen Tokamak also füllt man etwas Gas, legt ein Magnetfeld an, heizt das Ganze auf 150 Millionen Grad und wartet auf die Kernfusion. Seit sechs Jahrzehnten wurden bisher in verschiedenen Ländern Dutzende solcher Maschinen gebaut. „Und“, werden Sie jetzt fragen „hat man tatsächlich Kernfusion bekommen? Hat es geklappt?“
Im Prinzip ja, allerdings hat man immer weniger Energie herausbekommen, als man zum Heizen des Plasmas reingesteckt hat. Dieses Verhältnis, der Q-Faktor, war immer kleiner als eins. Dennoch hat man die Hoffnung nicht aufgegeben. Man hat gelernt, dass die Chancen umso besser sind, je größer man das Ding macht.
Und so entschloss man sich zum Bau von ITER, dem Jumbo aller Tokamaks, der hoffentlich kein Weißer Elefant wird. Der Durchmesser seines Torus beträgt gut zwölf Meter. Wenn Sie sich nun diese „Donut“ als Adventskranz vorstellen, um den ein Band spiralförmig gewunden ist, dann bekommen Sie eine Vorstellung von den Magnetspulen welche dort zum Einsatz kommen.
Verdammt kalt
Allerdings sind die nicht aus rotem Chiffon, und auch nicht aus Kupfer, sondern aus einer chemischen Verbindung der Metalle Niob und Zinn (Nb3Sn). Zurecht fragen Sie vielleicht warum so kompliziert? Das Metall Kupfer hat doch auch einen recht niedrigen elektrischen Widerstand! Das mag schon sein, aber Nb3Sn hat gar keinen. Es ist ein „Supraleiter“. Da fließt der Strom, einmal angeschubst, von selber immer weiter.
Allerdings hat das seinen Preis. Alle Supraleiter und Supraleiterinnen müssen auf sehr niedriger Temperatur gehalten werden, in diesem Fall sind es vier Grad über null; allerdings über absolut null, das sind auch minus 269 Grad Celsius. Viele Tonnen Material in dieser Saukälte zu halten ist eine extreme Herausforderung für die Ingenieure, und es ist nur einer der vielen technologischen Superlative und Weltrekorde, wie sie beim Bau des ITER realisiert werden müssen.
Gemessen an Größe, Gewicht und Komplexität ist die Konstruktion dieser Maschine wohl eines der kompliziertesten Projekte, auf das sich die Menschheit je eingelassen hat, und auch eines der teuersten: die Angaben für die Kosten bewegen sich zwischen 18 und 65 Milliarden Dollar.
Wird es sein Ziel erreichen? Und wenn ja, wann?
2008 starteten die Erdbewegungen für den Bau in Südfrankreich.
Der Bau der Maschine sollte zehn Jahre dauern, und es war geplant, das „Erste Plasma“ im Jahr 2020 zu erzeugen. Dieser Meilenstein würde den Nachweis bringen, dass der ITER-Torus tatsächlich Plasma beherbergen kann, dass sich Magnetfelder, Vakuum, Ströme etc. tatsächlich so verhalten, wie berechnet. Man ist an diesem Punkt aber noch meilenweit von einer ersten Fusion entfernt, bei der tausendmal höhere Temperaturen herrschen müssen.
400 Sekunden
Diese erste Fusion war für ursprünglich für 2023 geplant. Der jüngste Fahrplan sieht jedoch vor, dass das erste Plasma im Jahr 2025 erreicht wird und die erste vollständige Fusion 2035. Die Meilensteine verschieben sich offensichtlich mit großen Schritten in die Zukunft, was bei der enormen Komplexität der Maschine nicht überrascht. Da sind Überraschungen unvermeidlich, und meist sind sie unangenehm.
Immerhin, wenn die Fusion 2035 klappt, haben wir dann also die Maschine, die uns unendliche Mengen sauberen Stroms liefert? Jetzt müssen wir die Katze aus dem Sack lassen: Die Antwort ist Nein. Das erklärte Ziel von ITER ist die Erzeugung eines Deuterium-Tritium-Plasmas in dem 400 Sekunden lang eine Fusionsleistung von 400 Megawatt erzeugt wird, wobei zur Heizung des Plasmas maximal 40 Megawatt eingespeist werden. Wenn das erreicht ist, dann hat ITER seine Schuldigkeit getan.
Die Erfahrungen mit ITER sollen dann in eine Maschine Namens „DEMO“ fließen, welche Fusionsleistung in mindestens 500 Megawatt Elektrizität umformen soll – und das vermutlich für einen Zeitraum von mehr als 400 Sekunden. Aber auch DEMO ist nur für die Demonstration und noch nicht für die routinemäßigen Einspeisung ins Netz gedacht.
Wird uns ITER – das ist auch das lateinische Wort für „der Weg“ – also den Weg zur störungsfreien Stromversorgung aus Kernfusion ebnen? Oder ist ITER ein Irrweg? Fragen Sie dazu Nostradamus.
In einer Vorlesung über Plasmaphysik hörte ich vor mehr als 50 Jahren den Professor Ewald Fünfer, Gründungsmitglied des Max-Planck-Instituts in Garching bei München, die berühmten Worte sagen:
„Das wird noch 30 Jahre dauern“.
Inzwischen hat sich der Zusatz eingebürgert: „… und es wird immer so sein.“
Dieser Artikel erschien zuerst im Blog des Autors Think-Again. Sein Bestseller „Grün und Dumm“ ist bei Amazon erhältlich.