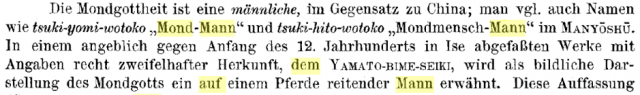Viel von den kommenden Nöten erfährt man
in einem äußerst informativen Interview, das der Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung, Eric Gujer, und die Politikphilosophin Katja Gentinetta mit Suzanne Thoma mustergültig geführt haben.
Thoma ist studierte Chemieingenieurin, arbeitete lange bei dem Schweizer Chemiekonzern Ciba, und soll jetzt als CEO die Bernischen Kraftwerke BKW neu aufstellen. Dieser drittgrößte Stromkonzern der Schweiz ist heftig ins Schlingern geraten, seitdem auch die Schweizer in einer Volksabstimmung für so etwas Ähnliches wie eine Energiewende gestimmt haben.
Denn man glaubt es kaum: In der Schweiz sprudeln zwar schier unerschöpfliche Mengen an Wasser von den Bergen herunter und entzücken grüne Gemüter, weil es ja so schön umweltfreundlich ist und CO2-frei, aber mit dieser Wasserkrafterzeugung scheint es vorbei zu sein. Die Berge schicken scheinbar doch eine Rechnung, und die fällt sehr hoch aus. Zu hoch für die Energieversorger. Die beklagen sich über exorbitant erhöhte Steuern, mit der die Wasserkraft belegt wurde und die die Stromerzeugung aus Wasser unattraktiv macht.
Dazu kommen die stark gesunkenen Preise für Strom auf dem europäischen Markt. Strom ist so billig wie nie zuvor. Das führt dazu, dass ein Teil der schweizerischen Wasserkraftwerke ihre Kosten nicht mehr decken kann. »Die Wasserkraft wird im Augenblick etwas aus dem Paradies oder aus dem Wohlfühl-Bereich vertrieben«, formuliert Suzanne Thoma blumig knallharte betriebswirtschaftliche Realität. »Warum ist das so? Weil auch die Wasserkraft, die in der Schweiz ist, steht auch im internationalen europäischen Wettbewerb. Sie steht in Konkurrenz mit anderen Produktionstechnologien und mit anderen Ländern und muss sich bewähren.«»Das ist zwar eine Herausforderung, die nicht neu ist, der Strommarkt ist de facto schon länger liberalisiert. Aber was seit einigen Jahren passiert, ist, ist dass sich der Strompreis dramatisch reduziert hat, er hat sich halbiert. Und damit steht die Wasserkraft und auch die Stromkonzerne, auch die BKW, vor einer massiven Herausforderung. So musste sich auch unser Unternehmen vor ein paar Jahren neu erfinden, weil wir sonst so wie die Titanik Richtung Eisberg uns bewegt hätten.«
Die Moderatorin Katja Gentinetta fragt: »Wir können uns überhaupt nicht mehr darauf verlassen, dass es diese Seen gibt, das Wasser, und dass die Schweiz im nationalen Umfeld geschützt ist?«
Die Schweiz ist zwar mittlerweile zur Drehscheibe des europäischen Strommarktes geworden. Doch so Thoma: »Die Frage ist, wie viel Strom man noch in der Schweiz produzieren möchte?« Das läuft dann auf die simple Frage der Wettbewerbsfähigkeit hinaus. »Und da steht die Schweiz aus verschiedenen Gründen nicht so gut da. Einmal aus den Kostengründen, die Unkosten sind hoch. Es ist teuer, in der Schweiz zu produzieren, auch in der Wasserkraft, nicht nur in der Industrie. Gleichzeitig hat man das Währungsrisiko. Wir fakturieren letztendlich in Euro mit einem starken Schweizer Franken.«
Sie fragt für die Bernischen Kraftwerke BKW: »Wie geht man eigentlich um mit der Wasserkraft? Die wird hoch besteuert in der Schweiz und steht in Konkurrenz mit anderen Produktionstechnologien, die nicht besteuert werden.«
Bedroht von der deutschen Energiewende und der nachfolgenden Schweizer Wende. Chefredakteur Eric Gujer: »Die Schweiz hat nach Merkel auch so eine halbe Energiewende gemacht. Wie sinnvoll war diese ganze Übung?«
Suzanne Thoma: »Ich denke, es zeigt etwas über die Entwicklung der Energiewende global. Ursprünglich hat man damit angefangen, und weltweit ist es auch noch der Fokus, nämlich die Reduktion von CO2. Weltweit geht es bei der Energiewende in erster Linie um die Reduzierung von CO2. Ich nehme an, ich kann nicht direkt in den Kopf von Frau Merkel sehen, aber ich nehme an, das war ihre Hauptüberlegung damals. Dann kam Fukushima und die politische Einschätzung, dass die Kernkraft in der Bevölkerung nicht mehr genügend Unterstützung besitzt. Und dann ist man etwas weggegangen von der CO2 Problematik in der Schweiz und in Europa hin zur Energiewende. Das heißt in erster Linie: Ausstieg aus der Nuklearenergie.« »Und jetzt habe ich den Eindruck, korrigiert sich das schon wieder etwas, aber der Ausstieg ist natürlich beschlossene Sache.«Gujer hakt noch einmal nach: »Wie sinnvoll ist das Ganze? Wenn ich mir jetzt Deutschland anschaue, dann ist seit 2009 der CO2 Ausstoß faktisch konstant. Danach hat sich nicht mehr viel getan. Die meisten Reduktionen kamen mit der Abschaltung der Dreckschleudern in der ehemaligen DDR. Als das erledigt war, ging es dann nur noch marginal zurück. Also muss man sagen: Für den Klimaschutz hat die ganze Geschichte bis dato relativ wenig gebracht.«
Thoma pflichtet bei: »Wenn Sie die Schweiz und wenn Sie Deutschland anschauen – dann stimmt das. Wenn Sie eine globale Perspektive einnehmen, also zum Beispiel die Vereinigten Staaten – die haben große Fortschritte gemacht. Auch in China ist neben dem Aspekt der Umweltverschmutzung die CO2 Reduktion ein sehr wesentlicher Punkt.«
Sie verweist als Gegenteil auf das Beispiel Finnland. Dort geht nach langen Jahren und großen Schwierigkeiten ein großer Kernreaktor ans Netz. Thoma: »Das ist ein Ding! Das ist fünfmal Mühleberg. Da gibt es keine Opposition dagegen!« Mühlenberg ist ein mit 370 MW elektrischer Leistung ein eher kleines und älteres Kernkraftwerk in der Schweiz.
Gujer: »Die Schweiz hat nach einem Referendum die Energiestrategie 2050 beschlossen: Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, weniger Energieverbrauch – es geht alles in diese Richtung – ist damit der Weg vorgegeben?«
Suzanne Thoma antwortet mit zur Schau gestelltem Optimismus, wie sich das Anteilseigner von einer Geschäftsführung erwarten: »Es ist für uns eine neue Rahmenbedingung, die uns in erster Linie auch neue Geschäftsmöglichkeiten gibt.«
Die BKW müsse sich gewissermaßen neu erfinden, weil sie mit dem bisherigen Geschäft der Energieproduktion nicht mehr gut leben könne. Sie versucht, die politisch korrekte neue Geschäftsmöglichkeit anzupreisen: »Es ist eine positive Rahmenbedingung, um den Leuten helfen zu können, Strom zu sparen.«
Doch ob der neue Geschäftszweig, anderen beim Strom zu helfen, so ertragreich wie das ehemalige Geschäft der Stromproduktion sein wird, bleibt offen. »Ansonsten«, da muss sie nachdenken, »ansonsten ist die Energiestrategie der Schweiz, wo wirklich, wirklich entschieden wird, was läuft, für uns als Investoren China.«
Gujer: »Wäre es nicht viel sinnvoller, wenn es ums globale Weltklima geht, wir konzentrierten uns auf die wirklichen großen Verbraucher und Produzenten von CO2, nämlich China, Indien, die für einen ganz großen Teil der Emissionen stehen, und sparen uns solche Mikroarbeiten, wie sie die Energiestrategie ( in der Schweiz) bedeutet.«
Thoma: »Sie stellen mir da vor allem eine politische Frage. Ich vertrete hier die BKW, die sich in diesem Umfeld positioniert, und aus der neuen Situation versucht, eine möglichst gute Lösung zu finden.«
Die eidgenössische Energiewirtschaft investiert eher in norddeutsche Windanlagen und nicht mehr in die Stromproduktion in der Schweiz. Ungelöst bleibt damit das absehbare Problem, dass im Sommer zu viel und im Winter zu wenig Strom produziert werde. Thoma daher: »Wir müssen uns ganz sicher sein, ob die Nachbarn dann immer auch exportieren können und wollen und zwar nicht im Durchschnitt über ein Jahr, sondern eben auch in Extremsituationen im Winter.«Doch damit steht nichts anderes als die Versorgungssicherheit auf dem Spiel. Sollten in anderen Ländern gerade auch Mangel an Strom herrschen, weil europaweite Flaute herrscht, dann gibt es keinen Strom mehr zu kaufen. Der liegt nicht wie Reis, Weizen oder Milch auf Vorrat in einem Lager und kann abgeholt werden. Es muss in genau dem Augenblick erzeugt werden, in dem er verbraucht wird. Europaweit.
Thoma bringt ins Spiel, was auch deutsche Stromproduzenten umtreibt: Sie müssen Kraftwerkskapazitäten vorhalten, die den Großteil des Jahres über nicht laufen und keinen Strom produzieren: »Da stellt sich dann die Frage, wenn man sagt, man möchte doch etwas Reserve haben, wie müssen denn die Rahmenbedingungen sein, dass eine Firma wie beispielsweise die BKW sagen würde: ja, wir bauen jetzt ein Kraftwerk, das 360 Tage im Jahr nicht läuft. Aber wir halten es als Versicherungsleistung zurück für die fünf Tage im Jahr, wo man es vielleicht dann braucht. Nur dann können Sie nicht nur die Kilowattstunde bezahlen, also nicht nur die Energiemenge, sondern Sie müssen die Dienstleistung bezahlen.«
Gujer entgegnet: »Sie rufen also schon nach einer neuen Subvention, damit Sie eine Leistung erbringen. Das ist mein Problem mit der ganzen Energiestrategie 2050. Es passiert ja nicht das, was Sie ja eigentlich fordern, nämlich dass der Markt ent-scheidet, wo man am vernünftigsten Energie spart und mit welchen Methoden man das macht, sondern es ist ein sehr dirigistischer Ansatz. Es wird wieder politisch festgelegt: Nicht der Markt entscheidet, sondern Bern und das Volk haben entschieden. Damit alle am Schluss ein bisschen zufrieden sind, gibt es für viele Gruppen auch noch Subventionen unter anderem auch für Sie die Marktabgabe. Es wird also auch noch ein relativ teurer Spaß. Das erscheint mir politisch vielleicht ein gangbarer Weg, aber wenn wir darüber reden, wie sinnvoll die ganze Übung ist, erschließt sich mir deren Sinn nicht wirklich.«
Thoma entgegnet: »Die Marktabgabe wollten wir eigentlich nicht. Das ist eine Versicherung und keine Subvention. Das ist eine Leistung, die man erbringen würde. Aber es ist – da haben Sie recht – ein politischer Entscheid.«
Die BKW richtet sich jetzt auf neue Rahmenbedingung aus. »Das führt schon dazu – und ich beklage mich nicht –, dass wir unser Energiegeschäft neu definieren. Wir reduzieren die Energie, die wir produzieren. Wir hören mit der Produktion Mühleberg auf. Wir haben gewisse Lieferverträge gekündigt. Wir sagen als BKW: Wir behalten zwar das Energiegeschäft, aber es soll im Gesamtportfolio, von dem, was wir machen, kleiner werden und eine kleinere Bedeutung haben, weil letztendlich der Investitionscase nicht gegeben ist.«
Dann spricht sie den entscheidenden Punkt an: »Vielleicht ist das ja für die Schweiz richtig. Es ist dann richtig, wenn man zum Schluss kommt, dass Importieren immer gegeben ist und dieses Risiko, dass ich vorher erwähnt habe, dass man einmal nicht importieren kann, dass das tragfähig ist.«
Thema: Versorgungssicherheit. Ein Land nimmt das Risiko auf sich, wenn kein Strom zur Verfügung am Markt verfügbar sein sollte, dann gibt es eben keinen.
Katja Gentinetta fragt folgerichtig: »Wer ist zuständig, wenn Sie sich zurückzuziehen?«
Es wird keinen verantwortlichen Stromproduzenten mehr geben. Suzanne Thoma verweist auf den Markt: »Zuständig wäre der Markt. Wenn der Preis steigt, wird mehr zugebaut. Und wenn der Preis sinkt, dann gibt es eine Korrektur. Das ist die Idee hinter dem Strommarkt.«
Nur werde der Markt auch aufgrund politischer Eingriffe verzerrt. In jedem Fall sind nicht, das sagt sie ganz klar, die Energiekonzerne zuständig. »Wir haben keinen Leistungsauftrag. Wir haben keine Pflicht, eine Stromproduktion zu haben. Da steht nirgend in einem Gesetz und auch nicht in unseren Statuten. Wir hatten sicher in der Vergangenheit das Selbstverständnis – das war unsere Raison d’etre – . Das ist jetzt der Umbau, den wir mit der BKW machen. Wir sagen: Diese Stromproduktion hat uns fast vor eine Wand gefahren. Und wir haben früh genug die Kurve genommen und eben nicht mehr investiert und andere Geschäftsfelder aufgebaut.«Einen Strommangel gebe es in Europa insgesamt nicht, stellt Gujer fest und verweist auf Deutschland: »Im letzten Jahr an 150 Tagen im Jahr mussten die Stromversorger sogar etwas zahlen, dass man ihnen den Strom abgenommen hat!«
»Wäre es da nicht konsequent zu sagen: Energiesicherheit heißt für uns in der Schweiz: Wir brauchen europaweit ein gutes Netz, ein stabiles Netz, und wir kaufen das, was wir in der Spitze vielleicht einmal benötigen, einfach ein und dann brauchen wir selber gar nicht so sehr schauen, was wir da an Versorgungssicherheit machen, denn der europäische Markt liefert es uns.«
Thoma in erfrischender Deutlichkeit, die man sich von deutschen Energiemanagern wünscht: »Wenn ich Ihnen so zuhöre, kommt mir das Bild vom Menschen, der mit dem Kopf im Backofen und den Füßen im Eiswasser ist. Also im Durchschnitt ist das ja gar keine so unangenehme Situation. Sie haben Recht: Es gibt zu viel Strom, darum ist der Preis ja auch so tief. Aber die Stromschwemme ist eben nicht gleichmäßig übers Jahr verteilt. Strom im Gegensatz zum Erdgas oder Erdgas oder Erdöl ist eben sehr schwierig zu speichern.«
Europa werde zu einer Art »Kupferplatte«. Es komme nicht mehr darauf an, wo der Strom produziert wird. Man könne ihn zum Beispiel von Spanien aus dem Süden nach Deutschland transportieren. »Aber bauen Sie mal diese großen Stromleitungen!«
Gujer verweist auf die erheblichen Marktverzerrungen: »Deutschland drückt mit sehr viel Geld – die Stromabgabe, die der Verbraucher zahlt, kostet 25 Milliarden € im Jahr -, seinen Strom in die europäischen Netze und verzerrt damit die Situation in den anderen Ländern. Ist das ein deutscher Stromimperialismus?«
Thoma: »Wir haben einen freien internationalen Markt. Da sehe ich nichts Imperiales dran. Ich sehe den Markt, allerdings einen verzerrter Markt. Sie haben einerseits die erneuerbaren, die nach wie vor subventioniert werden. Dann haben sie den politischen Entscheid auf europäischer Ebene, CO2 zu vermeiden.«
Katja Gentinetta: »Andere Länder können mit Wasserkraft günstiger produzieren. Die Schweiz hat sich dazu entschieden, das nicht zu fördern.«
Thoma: »Sie hat sich nicht nur entschieden, es nicht zu fördern, sie hat sich entschieden, es steuerlich relativ heftig zu belasten. Das ist schon ein mutiger Entscheid und für mich ein Beispiel, wo man einen Ast absägt, auf dem man sitzt.«
Die Energieversorger in der Schweiz erhalten von Seiten der Politik verschiedene Signale, einerseits will man gerne Wasserkraft nutzen und gleichzeitig will man es offenbar doch nicht wirklich. Für Thoma die einzige Folgerung aus betrieblicher Sicht: »Wir richten uns darauf ein, wir bauen die Firma deswegen um.«
Die Besteuerung der Wasserkraft in der Schweiz sei, stellt sie fest, extrem hoch geworden. »Sie ist der größte Kostenfaktor bei den Energieerzeugern, an dem sie auch nichts machen können.«
»Ich würde das Klima um die Energieproduktion in der Schweiz etwas freundlicher gestalten.« Drückt sie es vorsichtig aus.
Sie führt das Beispiel der Kernenergie an. Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre wollten alle, dass man in die Kernenergie investiert. Für die Strombranche wäre Kohlekraftwerke einfacher gewesen. »Jetzt am Ende der Laufzeit dieser Technologie sind die Stromkonzerne die, die auch infrage gestellt werden wegen den Entsorgungskosten. Und das ist eine ganz schreckliche Vision, dass die Gesellschaft auch ein paar Franken dran zahlen müsste. Wir wollten diese Kernkraft nicht. Wer sagt uns, dass es nicht ähnliche Gedanken zur Wasserkraft geben wird in 50 Jahren? Wie konntet ihr nur die Berge aushöhlen und das Wasser fassen?«»So gilt heute bei fast allen Energiekonzernen die Regel: Vorsicht bei Investitionen in die Energie Infrastruktur!«
Die BKW sieht sich nunmehr als Investor, der das Geld der Aktionäre dort investiert, wo das Verhältnis zwischen Ertrag und Risiko am besten ist. »Es ist tatsächlich so, dass in einem Windpark im Norden Deutschlands die Ertragswahrscheinlichkeit und die Risiken, denen wir uns aussetzen, deutlich kleiner sind, als wenn wir in der Schweiz ein Wasserkraftprojekt umsetzen würden.«
So bleibt letztlich die Frage von Eric Gujer unbeantwortet: »Wer sichert am Ende in Europa die Versorgungssicherheit?«
Und zwar dann, wenn aufgrund der Jahreszeiten zu wenig Strom produziert wird. Denn Strom ist nicht gleich Strom. In herbstlichen und winterlichen Hochdrucklagen herrscht meist viel Nebel und wenig Wind. Strom gibt es dann eher wenig, schon gleich gar nicht, sollten alle Kraftwerke abgeschaltet worden sein.
Was vom angeführten Rückgrat der europäischen Stromversorgung zu halten ist, zeigt sich derzeit ziemlich deutlich. Denn die Stauseen in den Schweizer Bergen sind derzeit gerade sehr leer. Der lange Winter sorgte einerseits für hohen Strombedarf auch in der Schweiz, andererseits dafür, dass aufgrund der langen Schneesaison kaum Wasser in die leeren Seen nachfließen konnte. Die Schweiz meldet derzeit Pegelstände in den Bergseen auf einem Rekordtief.
Mal eben von der Schweizer Swissgrid telefonisch eine Notreserve von 300 MW zu erbitten wie im Februar 2012, um einen Blackout in Bayern und Baden-Württemberg abzuwenden, ist dann nicht mehr möglich. Dann wird auch ein horrendes Angebot mit irrsinnig viel Geld nicht nutzen; damals wurden pro Megawattstunde 3.000 Euro bezahlt, 50 mal mehr als der Börsenpreis. Wenn kein Strom mehr da ist, dann kann er auch mit noch so viel Geld nicht beschafft werden.
Da bekommt die deutsche Vorstellung von den Bergseen in den Alpen als »Batterien Europas« für den Zeitpunkt, da alle Kern- und Kohlekraftwerke abeschaltet sein sollen, eine besonders irrlichternde Komponente.
Übernommen von Tichys Einblick hier